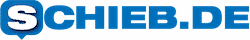11.11.2010 | Tipps
Der Bundesgerichtshof hat sich jetzt mit einer durchaus interessanten Frage beschäftigen müssen: Was passiert, wenn jemand einen DSL-Anschluss für ein oder zwei Jahre bucht und vor Vertragsende umzieht? Sein Problem, urteilt der BGH – zu Recht!
12.05.2010 | Tipps
Der BGH hat ein kluges Urteil gefällt: Ja, auch private WLAN-Betreiber müssen ihr WLAN absichern, damit Fremde keinen Zugang bekommen, anderenfalls handeln sie fahrlässig. Das kann ich nachvollziehen. Und: Nein, Privatleute müssen nicht dafür haften, wenn Fremde ins WLAN eindrucken und Unsinn anstellen.
30.04.2010 | Tipps
Google durchsucht das Web nicht nur nach Texten, sondern auch nach Bildern, wenn man das möchte – und zeigt vorab Miniaturversionen dieser Bilder, so genannte Thumbnails.
Das hat einer Künstlerin aus Weimar überhaupt nicht gepasst, sie hat ihre Urheberrechte verletzt gesehen und geklagt. Jetzt hat der BGH als höchste Instanz entschieden: Google darf das, Google darf in seiner Bildersuche auch Minibilder als Vorschau zeigen, selbst von Kunstwerken – und ohne ausdrücklich um Erlaubnis zu bitten.