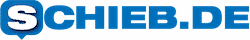Das Internet wächst rasant. Neben Computern drängt es auch immer mehr Mobilgeräte, Internettelefone und Unterhal-tungselektronik ins Netz. Allmählich wird der anhaltende An-drang zu einem Problem: Die Ressourcen werden knapp.
Flaschenhals ist der Adressraum. Jedem Rechner und Gerät wird für die Dauer der Online-Sitzung eine Kennung zugeteilt, eine Art Telefonnummer für den weltweiten Datenverbund. Diese IP-Adresse ist eine Ziffernkombination, bestehend aus vier Zahlen zwischen 0 und 255.
Während Großrechner, Webserver und Firmenrechner stets unter derselben Adresse im Netz erreichbar sind, bekommen Privatrechner, Notebooks oder Handys, die zum Beispiel über DSL oder Mobilfunknetze online gehen, jedes Mal eine andere Adresse zugewiesen. Jeder Internetprovider verfügt über einen Adresspool, den er auf alle Kunden verteilt. Für jeden Kunden oder gar jedes Gerät eine IP-Adresse fest zu reservieren, wäre viel zu teuer.
Allerdings wäre genau das wünschenswert. Wenn jedes Gerät über eine stets gleiche Adresse verfügt, macht das vieles einfacher: etwa die Verwaltung und das gezielte Ansprechen der Geräte. Für die stets populärer werdenden Internettelefone ist es fast schon zwingend erforderlich, über eine statische IP-Adresse zu verfügen. Nur so sind die Apparate bequem jederzeit erreichbar.
Jedem PC und jedem Gerät eine statische IP-Adresse zuzuteilen, ist derzeit allerdings unmöglich – der Adressraum, der ermöglicht, rund vier Milliarden Geräte anzusprechen, ist zu knapp bemessen. Als er Anfang der 80er Jahre aufgeteilt wurde, schien das zwar ausreichend. Doch viele der Adressen sind gar nicht nutzbar, da sie für Sonderaufgaben reserviert wurden.
Zudem ist der verfügbare Adressbereich ungerecht aufgeteilt. Über den mit Abstand größten Teil des Adresspools verfügt die USA: Rund 70 Prozent der IP-Adressen sind für Nordamerika reserviert. Allein die Stanford University, einer der ersten Unis, die ans Netz gegangen sind, verfügt über 16,8 Millionen Adressen. Auch Europa ist noch relativ großzügig ausgestattet. Schwieriger sieht es bei Nachzüglern wie Asien, Südamerika oder Afrika aus. Indien etwa muss sich mit zwei Millionen IP-Adressen bescheiden.
Die Adressen werden knapp
Vor allem in Asien, wo das Internet besonders schnell expandiert, werden nun die Adressen knapp. Zwar hat die Internet Engineering Task Force (IETF) bereits Anfang der 90er Jahre beschlossen, den Adressraum zu erweitern – doch erst jetzt macht die Internet-Wirtschaft ernst mit der Umstellung. Statt wie bisher Zahlenkolonnen mit vier Zahlen (IPv4), sollen künftig 128-Bit-Adressen zum Einsatz kommen. Ein Verfahren, das Techniker als IPv6 bezeichnen – als Internet Protocol Version 6. Damit lassen sich künftig genug Adressen unterscheiden, um jeden Quadratmillimeter der Erde mit 667 Billiarden Adressen auszustatten.
Ein Umstellen des gesamten Netzes von IPv4 auf IPv6 an einem Stichtag ist unmöglich. Darum werden Infrastruktur, Netzwerke, Hard- und Software nach und nach angepasst. Hard- und Software müssen mit den neuen, längeren Adressen klarkommen. Geräte und Programme müssen aber flexibel genug sein, um gleichzeitig alte und neue Adressen anwenden zu können.
Betriebssysteme wie Windows XP oder Linux sind bereits größtenteils auf das neue Internet-Zeitalter vorbereitet. Aber auch E-Mail-Programme, Server-Software, Firewalls sowie Programme, die den Zugang zum Internet ermöglichen, müssen angepasst werden. Ist das geschehen, kann ein Betreiber sein Netzwerk komplett auf IPv6 umstellen, ohne einen Ausfall zu riskieren.
Die Verwaltung der Geräte, die an ein IPv6-Netzwerk angeschlossen sind, wird deutlich einfacher. In der Regel reicht es aus, das Gerät mit dem jeweiligen Netzwerk zu verbinden. Die Konfiguration erfolgt dann automatisch. Eine Erweiterung namens Mobile IPv6 erlaubt darüber hinaus, mit derselben IP-Adresse überall erreichbar zu sein – zum Beispiel im heimischen Netzwerk und auf einer Konferenz.