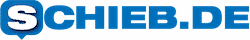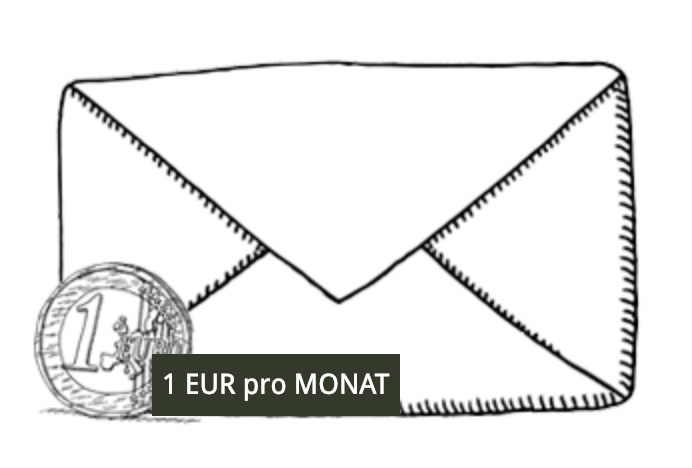
Onlinedienste wie Posteo müssen ihre Kunden kennen
Behörden wollten per richterlicher Anordnung von Posteo die IP-Adressen eines Tatverdächtigen bekommen. Doch der E-Mail-Anbieter erhebt und speichert diese Daten gar nicht – und konnte sie daher auch nicht zur Verfügung stellen. Doch das muss ein Onlinedienst...
EuGH lehnt Vorrats-Daten-Speicherung ab
Nun hat auch der europäische Gerichtshof EuGH der Vorratsdatenspeicherung eine Absage erteilt. Diese Woche urteilten die Richter: Die in der EU bereits praktizierte Vorratsdatenspeicherung ist nicht mit den Grundrechten vereinbar

Vorrats-Daten-Speicherung der EU ausgebremst
Ein EU-Generalanwalt hat sich die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung vorgeknöpft und näher untersucht. In den meisten EU-Ländern – mit Ausnahme von Deutschland – gibt es bereits eine Vorratsdatenspeicherung. Der Staat schreibt Telefon- und Internet-Unternehmen vor, relevante Nutzerdaten zu speichern.
Bundes-Verfassungs-Gericht beschränkt Daten-Nutzung – und Apps werden künftiger artiger
Das Bundesverfassungsgericht beeindruckt mich immer. Die Richter verstehen ganz genau, wie wichtig es ist, dass sich der Staat nicht überall einmischt, alles kontrolliert und reglementiert. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht geprüft, ob und unter welchen Umständen Ermittlungsbehörden Daten abrufen dürfen, die zum Beispiel Internetprovider oder Mobilfunkanbieter von uns haben. Klare Botschaft: Das Recht auf “informationelle Selbstbestimmung” ist auch sehr hohes Gut, das nur unter ganz bestimmten Umständen eingeschränkt werden darf.