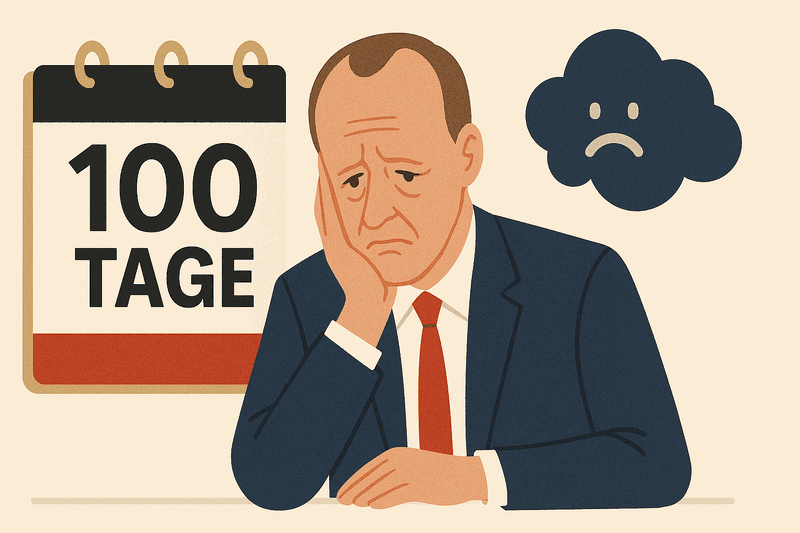Deutschland sollte endlich digital werden. KI-Weltmeister werden. Ein eigenständiges Digitalministerium sollte den Durchbruch bringen. Große Versprechen, große Erwartungen. Nach 100 Tagen Schwarz-Rot unter Bundeskanzler Friedrich Merz ist es Zeit für eine schonungslose Zwischenbilanz – und die fällt ernüchternd aus.
Das unsichtbare Digitalministerium
Karsten Wildberger – kennen Sie den Namen? Wahrscheinlich nicht. Und das ist bereits das Problem. Der neue Digitalminister, ein ehemaliger MediaMarkt-Saturn-CEO, ist in seinen ersten 100 Tagen Amtszeit praktisch unter dem Radar verschwunden. Statt mit innovativen Reformansätzen oder digitalen Durchbrüchen Schlagzeilen zu machen, glänzte das Ministerium vor allem durch Untätigkeit.
Die größte Meldung aus dem Digitalministerium in 100 Tagen? Man hat endlich einen Amtssitz gefunden. Das ist kein Scherz – das war tatsächlich die wichtigste „Erfolgs“-Nachricht aus Wildbergers Ressort. Dazu kommt die Gründung eines Ausschusses namens „Staatsmodernisierung und Bürokratieabbau“. Um Bürokratie abzubauen, wurde also erst einmal neue Bürokratie geschaffen. Satirischer geht es kaum.
Wildbergers Auftritte offenbaren das Grundproblem: Der Quereinsteiger ohne politische Berlin-Erfahrung wirkt fremdeling in der digitalen Szene. Auf der re:publica, der wichtigsten Digitalkonferenz Europas, bekam er nur verhaltenen Applaus. Seine Botschaft ist defensiv statt offensiv: In seiner ersten Bundestagsrede warnte er vor zu hohen Erwartungen und betonte, Digitalisierung brauche Zeit. Richtig, aber das hört sich nicht nach dem Aufbruch an, den Deutschland braucht.
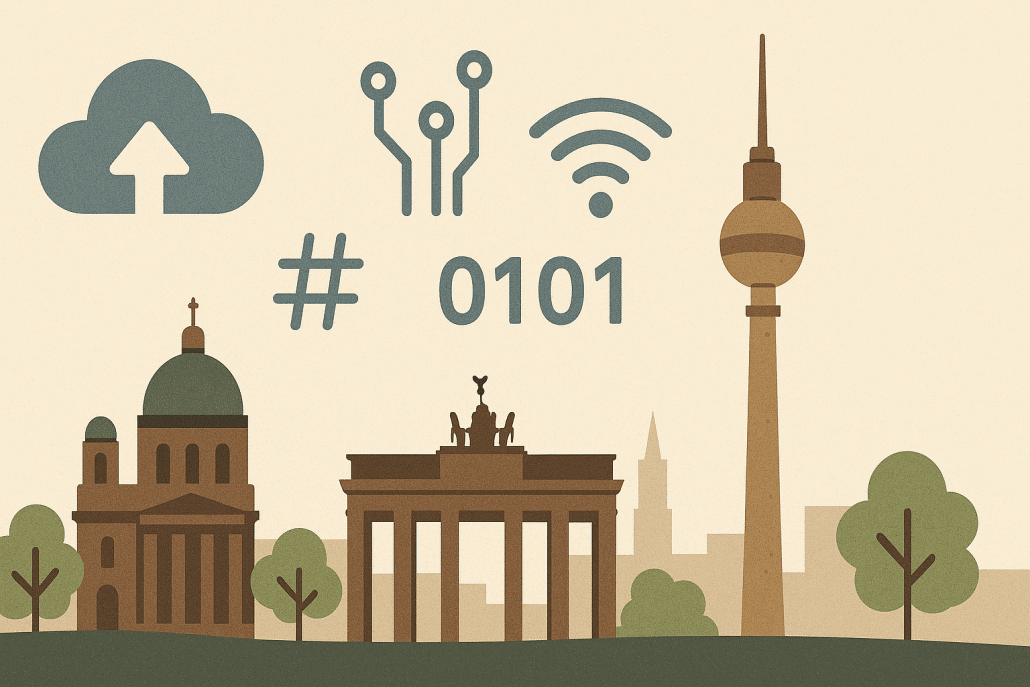
Kompetenzgerangel statt Durchschlagskraft
Das eigentliche Problem liegt tiefer: Drei Ministerien streiten sich um digitale Zuständigkeiten. Wildberger (Digitales), Dorothee Bär (Forschung) und Katherina Reiche (Wirtschaft) kämpfen um Kompetenzen, statt gemeinsam zu agieren. Während die Minister ihre Reviere abstecken, passiert das, was in Deutschland immer passiert, wenn zu viele Köche den Brei kochen: gar nichts.
Diese Zersplitterung ist Gift für eine moderne Digitalpolitik. Digitalisierung kennt keine Ressortgrenzen – sie durchdringt Wirtschaft, Bildung, Verwaltung, Kultur. Ein erfolgreiches Digitalministerium müsste als zentrale Koordinierungsstelle agieren und anderen Ministerien auf die Finger schauen. Stattdessen verstrickt es sich in Kompetenzgerangel.
Die Realitätsvergewisserung: Musk vs. Deutschland
Während in Berlin diskutiert wird, schaffen andere Fakten. Elon Musk hat in 122 Tagen eines der größten Rechenzentren der Welt gebaut – von der Planung bis zur Inbetriebnahme. 12 Milliarden Dollar investiert, 100.000 Hochleistungs-CPUs installiert. In Deutschland hätten die Behörden vermutlich allein 122 Tage für den Bauantrag gebraucht.
Das ist die harte Realität digitaler Wettbewerbsfähigkeit. Bundeskanzler Merz verkündet im Juni noch großspurig, Deutschland solle „führende KI-Nation“ werden. Schön und gut – aber wie? Mit welchen Maßnahmen? Mit welcher Geschwindigkeit? Von konkreten Schritten ist nichts zu sehen.
China investiert hunderte Milliarden in KI-Infrastruktur, die USA fördern ihre Tech-Giganten massiv, Estland digitalisiert seine gesamte Verwaltung – und Deutschland gründet Ausschüsse. Das ist nicht nur peinlich, sondern gefährlich für den Standort.
Weimers Medienpolitik: Richtige Idee, schlechte Umsetzung
Deutlich aktiver zeigt sich Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der mit seinem „Plattform-Soli“ für Aufregung sorgt. Seine Idee: Google, Meta & Co. sollen eine 10-Prozent-Abgabe auf Onlinewerbung zahlen, um deutsche Medien zu fördern. Grundsätzlich richtig – die Tech-Riesen zahlen in Deutschland viel zu wenig Steuern und dominieren den Werbemarkt komplett.
Aber Weimers Vorgehen ist handwerklich katastrophal. Er macht Politik per Medieninterview, statt erst die eigene Regierung zu einen. Das Ergebnis: Massive Kritik aus der eigenen Koalition. Wirtschaftsministerin Reiche und Fraktionschef Spahn warnen vor einem Zollstreit mit Washington. Wer erfolgreich gegen die Tech-Monopole vorgehen will, braucht eine durchdachte Strategie und geschlossene Reihen – nicht Einzelkämpfertum.
Die gesellschaftlichen Kosten des digitalen Stillstands
Was in Berlin wie politisches Geplänkel aussieht, hat reale Folgen für Millionen Menschen. Deutsche Unternehmen verlieren international an Boden, weil die digitale Infrastruktur hinterherhinkt. Schulen unterrichten noch immer mit Kreide statt Tablets. Behördengänge kosten Bürgerinnen und Bürgern unnötig Zeit und Nerven, weil Online-Services fehlen oder schlecht funktionieren.
Während andere Länder ihre Verwaltung digitalisieren, kämpft Deutschland noch immer mit dem Fax-Zeitalter. Während andere Staaten KI-Strategien umsetzen, sucht das deutsche Digitalministerium einen Amtssitz. Dieser Rückstand kostet Wohlstand, Arbeitsplätze und Zukunftschancen.
Der Weg nach vorn: Was jetzt passieren muss
Nach 100 Tagen ist klar: Die nächsten 100 Tage werden entscheidend. Entweder Wildberger findet zu echter Reformkraft, oder das Digitalministerium entpuppt sich als teurer Fehlschlag. Deutschland braucht digitalen Aufbruch, nicht digitale Verwaltung.
Konkret bedeutet das: Schluss mit dem Kompetenzgerangel zwischen den Ministerien. Wildberger muss sich als echter Digitalisierungs-Koordinator etablieren. Bürokratieabbau darf nicht nur Ankündigung bleiben, sondern muss messbare Ergebnisse liefern. Und die Regierung muss aufhören, Digitalisierung als Wirtschaftsfaktor zu sehen – sie ist eine gesellschaftliche Transformation.
Die Umfragen zeigen bereits die Quittung: 60 Prozent der Deutschen sind unzufrieden mit der Regierungsarbeit. In der Digitalpolitik gibt es noch viel Luft nach oben – aber die Zeit läuft davon. Andere Länder warten nicht auf Deutschland.
Das Digitalministerium war eine Chance. Jetzt muss es endlich eine werden.