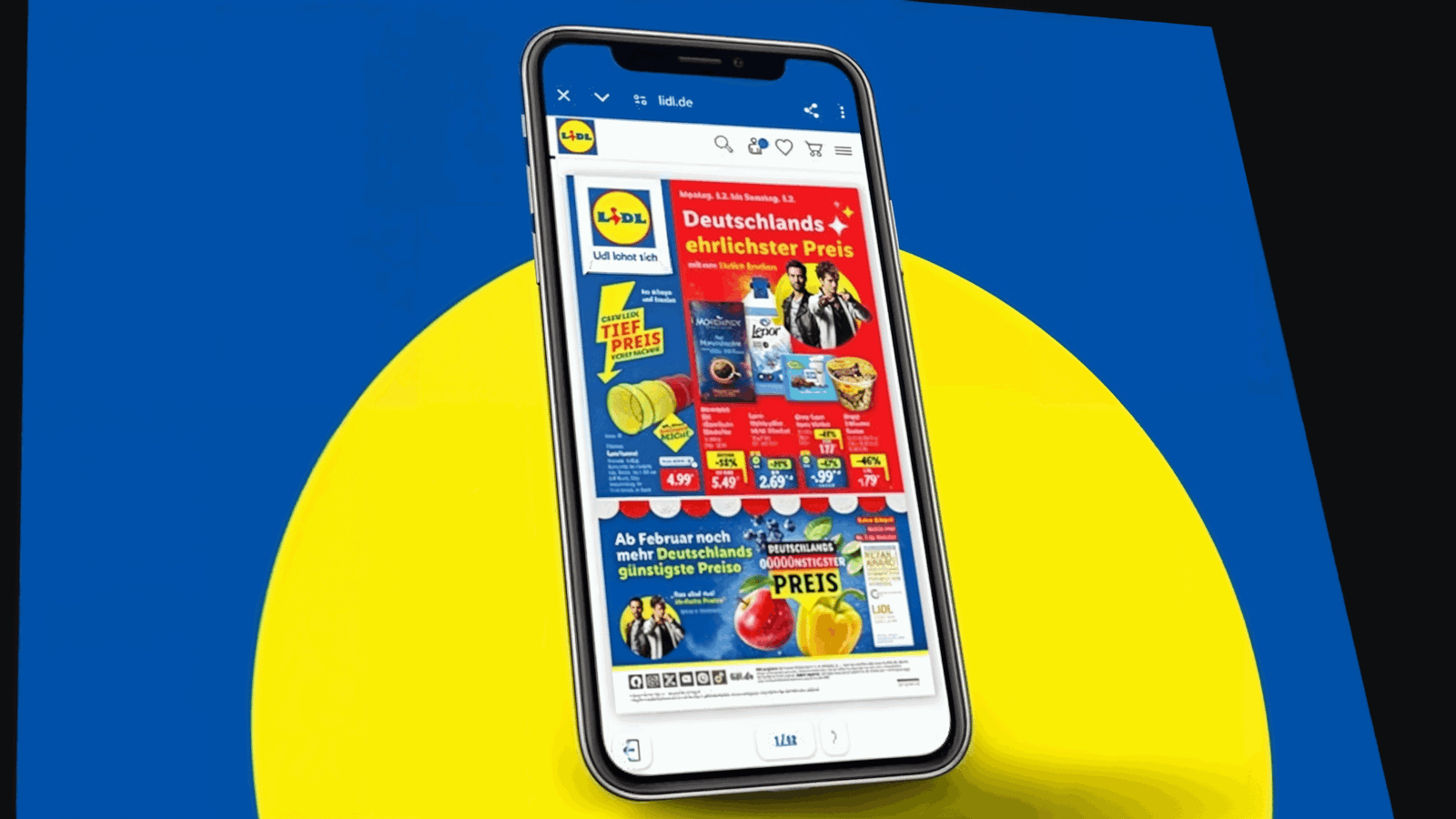Das Stuttgarter Oberlandesgericht wird am 23. September ein wegweisendes Urteil sprechen: Dürfen Supermärkte ihre Kundendatensammlung als „kostenlos“ bewerben? Der Fall gegen Lidls LidlPlus-App entlarvt ein perfides System – und zeigt, wie billig wir unsere Privatsphäre verkaufen.
Das Ende des anonymen Einkaufs
Stellen Sie sich vor, Sie gehen einkaufen und an der Kasse wartet ein Aufschlag von 20 Prozent – es sei denn, Sie verraten dem Kassenpersonal Ihr Geburtsdatum, Ihre Telefonnummer, wann Sie das letzte Mal Kondome gekauft haben und ob Sie lieber Wein oder Bier trinken. Absurd? Willkommen in der Realität des modernen Einzelhandels.
Das Oberlandesgericht Stuttgart verkündet am 23. September sein Urteil im Verfahren gegen Lidl. Es geht um die LidlPlus-App und die Frage, ob der Discounter seine Kunden hinreichend darüber aufklärt, dass sie ihre „kostenlosen“ Rabatte mit persönlichen Daten bezahlen. Ein scheinbar technisches Verfahren – das aber nichts weniger als die Zukunft des Datenschutzes im Handel entscheiden könnte.
Die Zahlen sind erschreckend: Mehr als 100 Millionen Kunden nutzen weltweit die „Lidl Plus“-App, um von Rabatten und Aktionen zu profitieren. In Deutschland haben 72 Prozent der Verbraucher mindestens eine App von Lebensmittelhändlern installiert – im Vorjahr waren es noch 58 Prozent. Im Durchschnitt sammeln sich vier Supermarkt-Apps pro Smartphone. Was wie ein harmloses Bonusprogramm aussieht, ist in Wahrheit die größte freiwillige Überwachungsaktion der Geschichte.
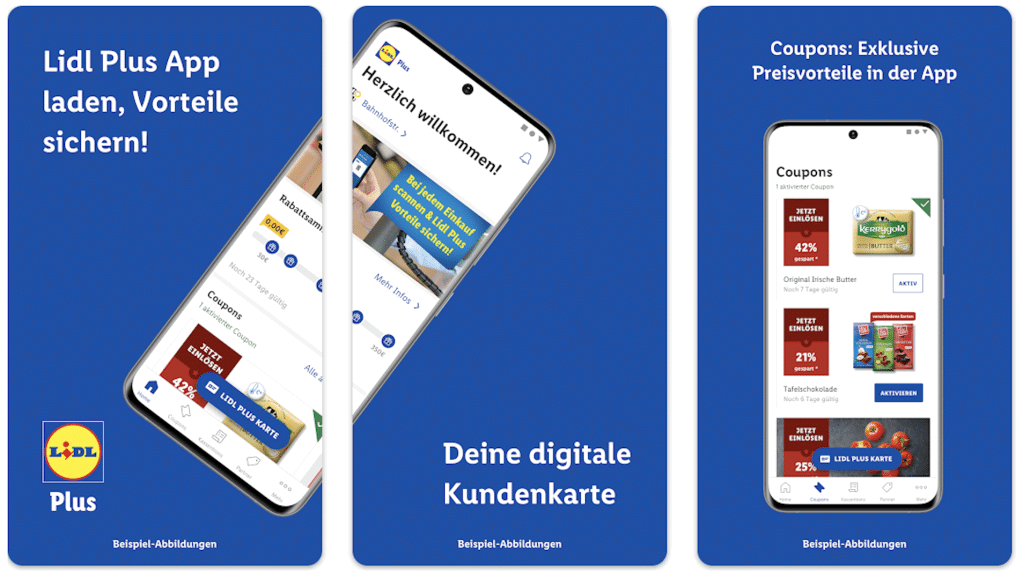
Die Anatomie der Datensammelwut
Wer die LidlPlus-App nutzt, gewährt dem Konzern tiefe Einblicke in sein Privatleben: Wo und wann wird eingekauft, welche Marken werden bevorzugt, wie viele Personen leben im Haushalt, welche Gesundheitsprodukte werden gekauft. Diese Informationen sind für Unternehmen Gold wert – sie ermöglichen personalisierte Werbung, Sortimentsoptimierung und detaillierte Kundenprofile.
Besonders perfide: Die Daten werden zu Marktforschungszwecken sogar an Google, Facebook und andere Marktforschungsinstitute weitergegeben. Ihr Einkaufsverhalten wird also nicht nur vom Discounter selbst analysiert, sondern fließt in die Algorithmus-Maschinerie der großen Tech-Konzerne ein. Christine Steffen von der Verbraucherzentrale NRW bringt es auf den Punkt: „Spar-Apps scheinen Konjunktur zu haben, weil derzeit jeder Euro zweimal umgedreht wird, bevor er ausgegeben wird.“
Das Zwei-Klassen-System der Preise
Was Lidl & Co. als „exklusive Rabatte“ bewerben, ist in Wahrheit oft nur eine Rückkehr zum normalen Preisniveau. Supermärkte haben ihre Grundpreise künstlich aufgebläht, um dann großzügige „App-Rabatte“ gewähren zu können. Ein klassischer Etikettenschwindel: Der vermeintliche Rabatt ist häufig nur die Korrektur eines überhöhten Grundpreises.
Stichproben bei Edeka und Rewe durch Verbraucherschützer ergaben zwar Rabatte von 5 bis 50 Prozent, doch Preisvergleichs-Apps zeigen, dass andere Händler die gleichen Produkte oft günstiger anbieten. Thomas Fuchs, Datenschutzbeauftragter in Hamburg, zieht eine ernüchternde Bilanz: „Dafür, dass ich so viele Daten von mir preisgebe, sind die Rabatte eigentlich viel zu gering – ich verkaufe meine Daten zu billig.“
Der rechtliche Showdown
Der Verbraucherzentrale Bundesverband wirft Lidl vor, weder vor Abschluss des Nutzungsvertrages noch in den Nutzungsbedingungen ausreichend darauf hinzuweisen, dass Verbraucher die App-Rabatte mit ihren persönlichen Daten bezahlen. Das klingt technisch, ist aber fundamental: Denn wenn Daten eine Währung sind – und das sind sie längst –, dann müssen Verbraucher wissen, was sie „ausgeben“.
Das Oberlandesgericht sieht in dem Fall eine grundsätzliche Rechtsfrage: Muss ein Gesamtpreis angegeben werden, auch wenn dieser nicht in Geld besteht? Und darf etwas als kostenlos bezeichnet werden, wenn zwar kein Geld fließt, aber eine andere Gegenleistung verlangt wird?
Die Richter haben bereits angekündigt, die Revision zum Bundesgerichtshof zuzulassen, da es sich um die Auslegung einer EU-Richtlinie handelt – möglicherweise wird sogar der Europäische Gerichtshof einbezogen. Das zeigt die Tragweite des Falls.
Mehr als nur Lidl: Eine ganze Branche unter Verdacht
Lidl ist nur der prominenteste Fall in einer Reihe ähnlicher Verfahren. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat diese Woche Klage gegen Edeka Südwest eingereicht, Penny hatte bereits einen entsprechenden Unterlassungsantrag anerkannt, und auch gegen Rewe läuft ein noch nicht abgeschlossenes Verfahren. Die gesamte Branche hat sich offenbar darauf verständigt, Kunden systematisch über die wahren Kosten ihrer „Bonusprogramme“ zu täuschen.
Parallel läuft bereits ein weiteres Verfahren vor dem Landgericht Heilbronn, wo der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg vorwirft, dass der reguläre Preis für Kunden ohne App nicht angegeben wurde. Im April musste sich Lidl in einem Vergleich verpflichten, in seiner gedruckten Werbung immer den Preis anzugeben, der für alle Kunden gilt – nicht nur für App-Nutzer.
Die Demokratie der Datenschnäppchen
Corona und Inflation haben diesen Trend befeuert. In einer Zeit, in der jeder Euro zählt, werden scheinbar kostenlose Apps zu unwiderstehlichen Verlockungen. Doch der Preis ist höher, als es auf den ersten Blick scheint: Wir opfern unsere Privatsphäre für ein paar Cent Rabatt und merken nicht, dass wir dabei den Grundstein für unsere eigene kommerzielle Überwachung legen.
Das perfide System funktioniert, weil es unsere kognitiven Schwächen ausnutzt: Wir sehen den sofortigen Rabatt an der Kasse, aber die langfristigen Kosten der Datenpreisgabe bleiben unsichtbar. Wie bei einem Darlehen zahlen wir den Preis erst später – in Form personalisierter Werbung, Preisdiskriminierung und dem Verlust unserer Anonymität.
Was jetzt passieren muss
Heiko Dünkel vom Verbraucherzentrale Bundesverband formuliert es klar: „Bonus-Apps sind grundsätzlich nicht zu beanstanden. Wenn aber exklusive Rabatte nur im Tausch gegen Daten zu bekommen sind, dann muss das transparent gemacht werden.“
Die Lösung ist einfach: Vollständige Transparenz über den Datenwert. Wenn Lidl für unsere Einkaufsdaten im Jahr etwa 50 Euro erhält (eine konservative Schätzung), dann soll das auch so kommuniziert werden. Statt „Kostenlose App mit tollen Rabatten“ sollte es heißen: „Jährliche Dateninvestition von 50 Euro für Rabatte im Wert von 30 Euro“. Dann können Verbraucher eine informierte Entscheidung treffen.
Bis dahin bleibt nur der Rat: Lassen Sie die Datensammlung bei manchen Apps wie Rewe teilweise deaktivieren, bestimmten Einwilligungen widersprechen und die Datenschutzbestimmungen genau im Auge behalten. Oder noch besser: Gehen Sie wieder öfter in kleine, lokale Geschäfte, wo Ihr Geld willkommen ist – nicht Ihre Daten.
Das Stuttgarter Urteil wird zeigen, ob unsere Gerichte den Mut haben, der Datensammelwut der Konzerne Grenzen zu setzen. Es geht um nicht weniger als die Frage: Haben Verbraucher das Recht zu wissen, mit welcher Währung sie tatsächlich bezahlen?
Das Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart wird am 23. September 2025 verkündet (Aktenzeichen 6 UKl 2/25). Unabhängig vom Ausgang ist eine Revision zum Bundesgerichtshof bereits angekündigt – der Rechtsstreit dürfte sich also noch Jahre hinziehen.