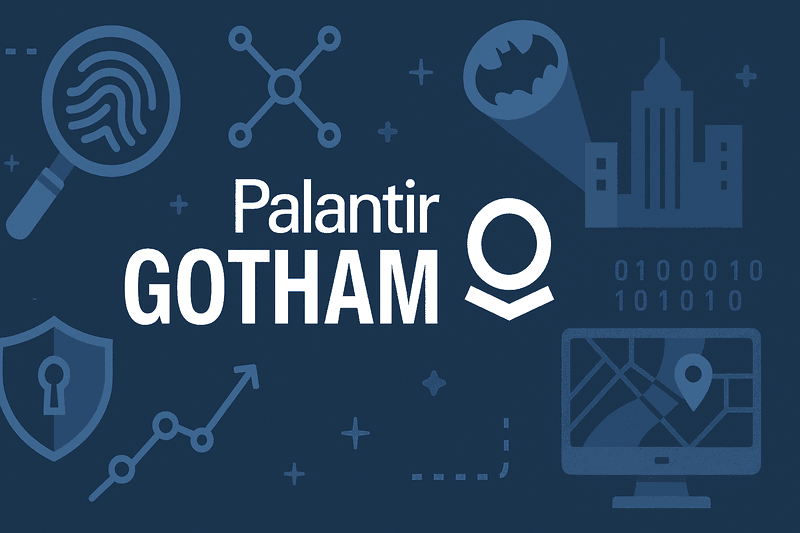Bayern, Hessen und NRW setzen bereits auf Palantirs Gotham-Software. Kritiker warnen vor dem gläsernen Bürger, Befürworter feiern Fahndungserfolge. Was kann die Technologie wirklich – und wo liegen die Grenzen?
Die deutsche Polizei kämpft mit Algorithmen gegen das Verbrechen. In Bayern durchleuchtet die Software „Gotham“ des US-Konzerns Palantir binnen Minuten komplexe Terrornetze. In Hessen spürt sie Geldwäsche-Strukturen auf. In NRW zerschlägt sie Drogenkartelle. Doch während die einen spektakuläre Erfolge feiern, laufen andere Sturm gegen die „Überwachungsmaschine aus Amerika“.

Die Datensammelmaschine im Einsatz
Gotham funktioniert wie ein digitaler Detektiv auf Steroiden. Die Software verknüpft Millionen von Datenpunkten – Handystandorte, Bankdaten, Verkehrskameras, soziale Medien, Kriminalakten – und macht Verbindungen sichtbar, die Menschen niemals entdecken würden.
Ein Beispiel aus der Praxis: Terrorverdacht in München. Früher hätten Ermittler wochenlang manuell Verbindungen gesucht. Heute füttert ein Beamter den Namen in Gotham ein. Sekunden später erscheint eine visuelle Karte: Wer hat wann mit wem telefoniert? Welche Bankkonten sind verknüpft? Wo bewegten sich die Verdächtigen?
Das Bayerische LKA schwärmt von der Effizienz. Hessen nutzt Gotham gegen Cybercrime. NRW zerschlägt damit Menschenhandelsringe. Die Bilanz: Dutzende aufgedeckte Straftaten, verhinderte Anschläge, gesparte Ermittlungsjahre.

Der Trump-Schatten über der Software
Doch Palantir trägt schweres Gepäck. Mitgegründet wurde der Konzern 2003 von Peter Thiel, dem Tech-Milliardär und glühenden Trump-Anhänger. Das Unternehmen verdient Milliarden mit US-Geheimdiensten und Immigration-Überwachung. Für Kritiker macht das Palantir zum „politischen Akteur“, dem man deutsche Bürgerdaten nicht anvertrauen sollte.
„Ein Unternehmen, das Einwanderer-Jagd für Trump macht, analysiert deutsche Polizeidaten“, ätzt ein Datenschutzaktivist. „Das ist wie den Bock zum Gärtner machen.“
Palantir wehrt ab: Man sei ein neutraler Technologieanbieter. Die politischen Ansichten der Gründer hätten nichts mit der Software zu tun. Deutsche Daten blieben in Deutschland.
Verfassungsrichter ziehen rote Linien
Das Bundesverfassungsgericht hat 2023 klare Grenzen gezogen: Automatisierte Datenanalyse braucht konkrete Verdachtsmomente, zeitliche Begrenzungen und richterliche Kontrolle. Trotzdem klagen Bürgerrechtler gegen Gotham.
Der Vorwurf: Die Software durchleuchte auch Unbescholtene. Wer zur falschen Zeit am falschen Ort ist, gerät ins Visier der Algorithmen. Ein Restaurantbesuch neben einem Verdächtigen reicht womöglich aus.
„Gotham macht jeden zum potenziellen Terroristen“, warnt ein Verfassungsrechtler. „Die Software entscheidet nach Geheimkriterien, wer verdächtig ist. Das widerspricht dem Transparenzgebot des Rechtsstaats.“
Föderaler Flickenteppich bei den Kontrollen
Baden-Württemberg reagiert vorsichtig: Das Parlament soll Gothams Einsatz überwachen. Es gibt zeitliche Begrenzungen und regelmäßige Evaluierungen. Andere Bundesländer sind großzügiger.
Das Problem: Jedes Land interpretiert die Verfassungsrichter-Vorgaben anders. In Bayern läuft Gotham mit weniger Auflagen als in Stuttgart. Deutsche Bürgerrechte hängen vom Wohnort ab.
„Wir brauchen bundesweite Standards“, fordert ein Datenschutzbeauftragter. „Sonst entsteht ein rechtsstaatlicher Flickenteppich.“
Die Monopol-Frage spaltet Experten
Palantir dominiert den Markt für Polizei-Datenanalyse. IBM, Microsoft und SAP bieten Alternativen, aber keine erreicht Gothams Leistung. Das macht Deutschland abhängig von amerikanischer Technologie.
Die EU fördert europäische „Digital Sovereignty“-Projekte. Frankreich und Deutschland entwickeln gemeinsame Lösungen. Doch die sind Jahre von der Marktreife entfernt.
Sicherheitsexperten stehen vor einem Dilemma: Sofort verfügbare US-Technologie oder jahrelanges Warten auf europäische Alternativen? „Während wir philosophieren, planen Terroristen Anschläge“, warnt ein BKA-Veteran.
Ideologie oder berechtigte Sorge?
Die Frankfurter Allgemeine wirft Palantir-Kritikern vor, aus Ideologie die Sicherheit zu gefährden. Bayern, Hessen und NRW hätten gute Erfahrungen gemacht. Peter Thiels Trump-Nähe sei kein Argument gegen die Software.
Doch die Kritik hat System. Deutschland prägen historische Erfahrungen mit Überwachungsstaaten. Stasi und Gestapo haben das Verhältnis zu staatlicher Datensammlung geprägt.
„Diese Vorsicht ist berechtigt“, sagt ein Historiker. „Technologie ist nicht neutral. Sie kann Demokratien stärken oder untergraben.“
Der Weg nach vorn: Kontrolle statt Verweigerung
Die Lösung liegt nicht im kategorischen Nein zu Palantir. Moderne Kriminalität braucht moderne Werkzeuge. Cybercrime, internationaler Terrorismus und organisiertes Verbrechen lassen sich nicht mit analogen Methoden bekämpfen.
Aber Deutschland muss Bedingungen stellen: Bundesweit einheitliche Kontrollen, parlamentarische Überwachung, richterliche Genehmigungen für jeden Einsatz. Die Algorithmen müssen transparenter werden, auch wenn das Geschäftsgeheimnisse berührt.
Gleichzeitig sollte Deutschland europäische Alternativen vorantreiben. Langfristig braucht Europa eigene Lösungen, um nicht von US-Konzernen abhängig zu bleiben.
Technologie mit demokratischen Leitplanken
Palantirs Gotham ist weder Teufelszeug noch Allheilmittel. Die Software kann Leben retten und Verbrechen verhindern. Sie kann aber auch in den Überwachungsstaat führen.
Entscheidend ist nicht, ob Deutschland die Technologie nutzt, sondern wie. Mit starken rechtsstaatlichen Kontrollen, transparenten Regeln und demokratischer Überwachung kann Gotham ein Werkzeug für mehr Sicherheit werden.
Ohne diese Leitplanken wird aus dem digitalen Detektiv ein Big Brother. Die Wahl liegt bei der Politik – und bei uns allen.