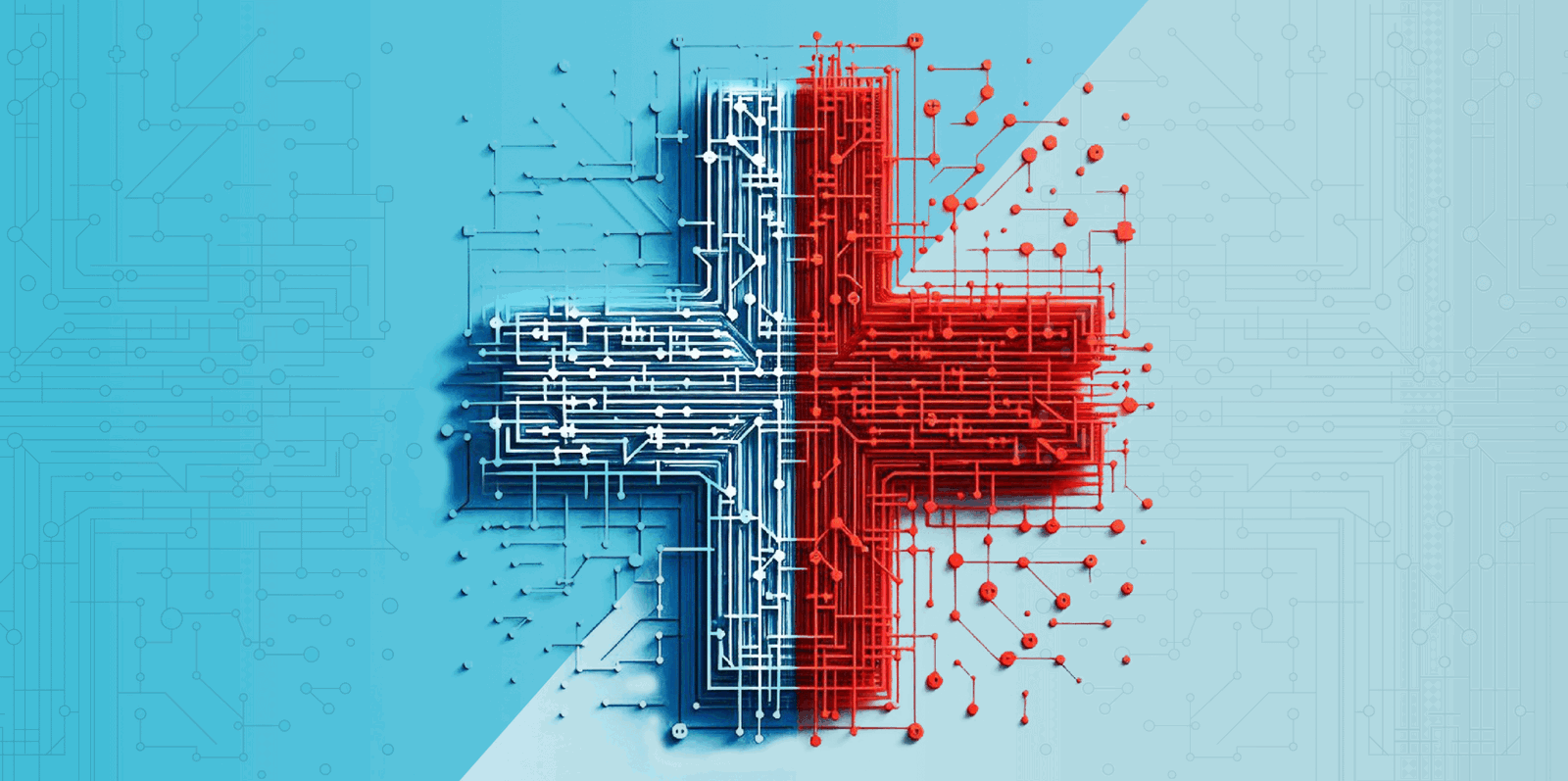Die Schweiz hat gestern mit Apertus ihr erstes eigenes KI-Sprachmodell veröffentlicht – und setzt damit ein wichtiges Zeichen für digitale Souveränität in Europa. Während die KI-Welt von amerikanischen Tech-Giganten und chinesischen Modellen dominiert wird, präsentieren die ETH Zürich, die EPFL Lausanne und das Nationale Supercomputing-Zentrum CSCS eine radikal transparente Alternative. Der Name ist Programm: Apertus kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „offen“.
Was macht Apertus so besonders?
Der entscheidende Unterschied zu ChatGPT, Claude oder Gemini liegt in der vollständigen Transparenz. Bei Apertus ist wirklich alles öffentlich einsehbar: der komplette Programmcode, die Modellarchitektur, sämtliche Trainingsdaten und sogar die verwendeten Trainingsmethoden. Das ist revolutionär, denn selbst bei sogenannten „Open-Source“-Modellen wie Llama von Meta bleiben die Trainingsdaten meist geheim.
Diese radikale Offenheit ist kein Zufall. Die Schweizer Forscher reagieren damit auf ein grundlegendes Problem der KI-Branche: Die meisten großen Sprachmodelle sind Black Boxes – niemand außer den Entwicklern weiß genau, wie sie funktionieren, welche Daten verwendet wurden oder ob bestimmte politische oder kommerzielle Interessen die Antworten beeinflussen. Bei Apertus kann jeder nachvollziehen, wie das Modell zu seinen Ergebnissen kommt.
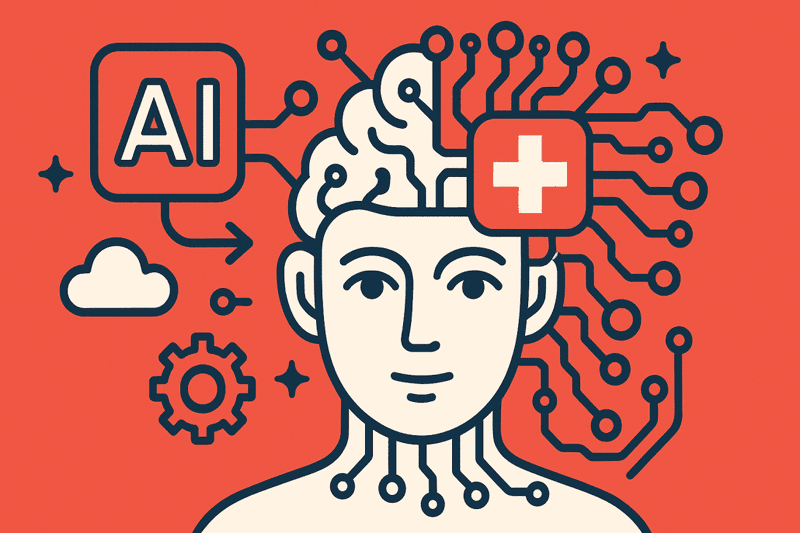
Warum ist eine europäische KI so wichtig?
Die Bedeutung geht weit über technische Details hinaus. Digitale Souveränität ist zu einer Frage der nationalen Sicherheit geworden. Wer seine kritische digitale Infrastruktur von amerikanischen oder chinesischen KI-Systemen abhängig macht, gibt Kontrolle über sensible Daten und Prozesse ab. Besonders brisant wird das bei Anwendungen im Gesundheitswesen, in der öffentlichen Verwaltung oder im Finanzsektor.
Apertus erfüllt als erstes großes KI-Modell weltweit vollständig die Transparenzanforderungen des EU AI Act, der strengen europäischen KI-Verordnung. Diese schreibt vor, dass KI-Systeme nachvollziehbar und erklärbar sein müssen. Während US-Unternehmen noch rätseln, wie sie diese Vorgaben erfüllen sollen, zeigt die Schweiz: Es geht – wenn man es von Anfang an richtig macht.
Die Schweizer haben bei der Entwicklung penibel auf die Einhaltung von Datenschutzgesetzen und Urheberrechten geachtet. Nur legal zugängliche, öffentliche Daten flossen ins Training ein. Websites, die ein Opt-out für KI-Training signalisiert hatten, wurden – sogar rückwirkend – respektiert. Das ist ein deutlicher Kontrast zu vielen anderen Modellen, die mit fragwürdigen Datenpraktiken trainiert wurden.
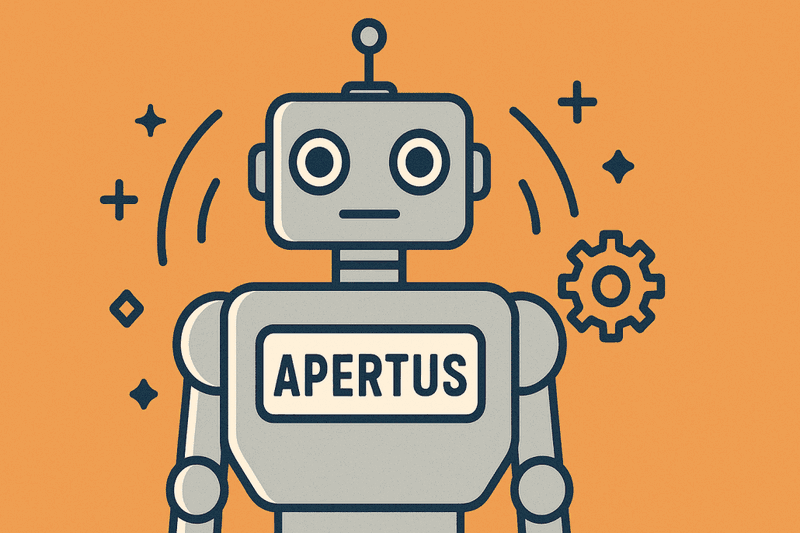
Was kann Apertus – und was nicht?
Apertus beherrscht über 1000 Sprachen, darunter auch Schweizerdeutsch und Rätoromanisch – Sprachen, die in anderen Modellen kaum vorkommen (aber in der Schweiz eine Rolle spielen). Das Modell wurde mit 15 Billionen Token trainiert, wobei bewusst 40 Prozent nicht-englische Daten verwendet wurden. Diese Mehrsprachigkeit macht es besonders wertvoll für den europäischen Markt.
Es gibt zwei Versionen: Eine „kleine“ mit 8 Milliarden Parametern und eine große mit 70 Milliarden Parametern. Zum Vergleich: Die besten kommerziellen Modelle haben vermutlich mehrere hundert Milliarden Parameter. Apertus liegt damit etwa auf dem Niveau von Metas Llama 3 aus dem Jahr 2024 – technisch solide, aber kein Spitzenreiter.
Wichtige Einschränkung: Apertus kommt ohne Chat-Interface. Man kann nicht einfach auf eine Website gehen und losplaudern wie bei ChatGPT. Das Modell ist als Basistechnologie gedacht, auf der Entwickler eigene Anwendungen aufbauen. Swisscom arbeitet bereits daran und wird Apertus auf ihrer Swiss AI Platform für Geschäftskunden verfügbar machen.
Wie kann man Apertus nutzen?
Theoretisch kann jeder das Modell kostenlos von der Plattform Hugging Face herunterladen. Die kleine 8-Milliarden-Version läuft sogar auf einem modernen Laptop – allerdings nur mit entsprechendem technischen Know-how. Für die praktische Nutzung braucht man:
- Technische Expertise: Man muss wissen, wie man ein LLM lokal installiert und betreibt
- Hardware: Für die kleine Version reicht ein leistungsstarker Laptop, für die große Version braucht man spezielle KI-Hardware mit mehreren High-End-Grafikkarten
- Software-Stack: Tools wie Ollama oder LM Studio für die lokale Ausführung
- Eigene Anwendung: Ein Chat-Interface oder eine andere Benutzeroberfläche muss selbst entwickelt oder installiert werden
Für normale Anwender ist das noch zu kompliziert. Aber genau hier liegt die Chance: Entwickler und Unternehmen können auf Apertus aufbauen und maßgeschneiderte Lösungen erstellen – Chatbots für Behörden, Übersetzungssysteme für Schweizer Dialekte oder KI-Assistenten für sensible Branchen wie Banken oder Versicherungen.
Die größere Vision
Apertus ist mehr als nur ein technisches Projekt. Es ist ein Statement für eine andere Art von KI-Entwicklung: transparent statt geheim, gemeinwohlorientiert statt profitgetrieben, mehrsprachig statt anglozentrisch. Die Schweizer Forscher sprechen bewusst nicht von einem Produkt, sondern von einem „Impulsgeber für Innovation“.
Die Entwicklung kostete erhebliche Ressourcen: Der Supercomputer Alps in Lugano rechnete monatelang, verschlang dabei Strom für 1,5 Millionen Franken und band bis zu 100 Forschende. Über 10 Millionen GPU-Stunden wurden investiert. Das zeigt: Europa kann große KI-Projekte stemmen – wenn der politische Wille da ist.
Fazit: Ein wichtiger erster Schritt
Apertus wird ChatGPT nicht vom Thron stoßen. Dafür ist es zu klein und zu technisch. Aber es beweist, dass Europa nicht nur regulieren, sondern auch eigene KI-Technologie entwickeln kann. Die vollständige Transparenz setzt neue Maßstäbe und zeigt, dass vertrauenswürdige KI möglich ist.
Für die digitale Souveränität Europas ist Apertus ein Meilenstein. Es gibt Unternehmen und Behörden eine Alternative zu den intransparenten Modellen aus USA und China. Besonders für sensible Anwendungen, bei denen Datenschutz und Nachvollziehbarkeit kritisch sind, könnte sich das Schweizer Modell als Gamechanger erweisen.
Die eigentliche Bewährungsprobe kommt jetzt: Werden Entwickler und Unternehmen Apertus tatsächlich nutzen? Entstehen daraus innovative Anwendungen? Die Hackathons der Swiss AI Weeks im September werden erste Antworten liefern. Eines ist aber jetzt schon klar: Europa hat gezeigt, dass es in der KI-Entwicklung mitspielen kann – auf seine eigene, transparente Art.