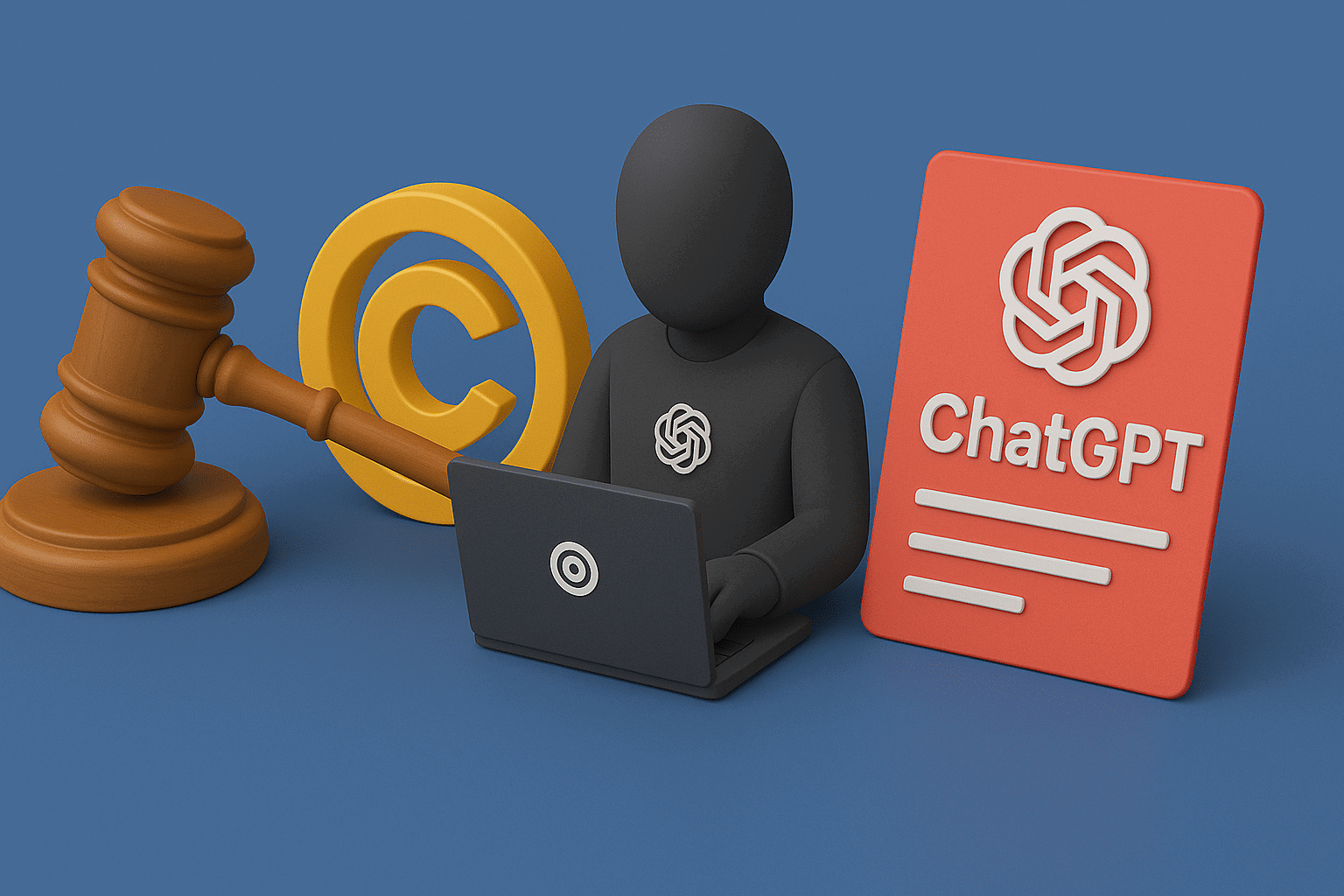Ein Münchner Gericht hat heute OpenAI verurteilt – wegen Urheberrechtsverletzung durch ChatGPT. Was erst mal nach trockenem Juristenkram klingt, betrifft uns alle. Denn es geht um die Frage: Dürfen sich KI-Systeme einfach bedienen, oder müssen auch Tech-Giganten für kreative Inhalte bezahlen?
Was ist passiert?
Das Landgericht München hat heute ein Grundsatzurteil gesprochen: OpenAI darf urheberrechtlich geschützte Songtexte nicht einfach für das Training und den Betrieb von ChatGPT verwenden. Die GEMA hatte geklagt, weil ChatGPT neun bekannte deutsche Songs auf Anfrage nahezu vollständig wiedergegeben hat – darunter „Atemlos“ von Kristina Bach, „Männer“ von Herbert Grönemeyer und „Über den Wolken“ von Reinhard Mey.
Der Knackpunkt: ChatGPT konnte diese Texte so präzise ausspucken, dass das Gericht davon ausgeht, sie müssen im System gespeichert („memorisiert“) worden sein. Und genau das ist ohne Lizenz eine Urheberrechtsverletzung.

Was hat die GEMA konkret vorgeworfen?
Die Verwertungsgesellschaft machte zwei zentrale Punkte geltend: Erstens hat OpenAI die Songtexte ohne Erlaubnis zum Training seiner KI verwendet. Zweitens gibt ChatGPT diese Texte auf simple Anfragen hin wieder aus – und zwar so exakt, dass sie quasi kopiert sein müssen.
Für beide Vorgänge – das Kopieren fürs Training und die Ausgabe an Nutzer – hätte OpenAI Lizenzen erwerben und die Urheber vergüten müssen. Hat das Unternehmen aber nicht. Und das, obwohl OpenAI mit ChatGPT bereits Milliardenumsätze macht.
Wie hat das Gericht entschieden?
Das Urteil ist eindeutig: OpenAI verletzt das Urheberrecht. Das Gericht hat dem US-Konzern untersagt, die Texte zu speichern und durch seine Modelle auszugeben. Außerdem muss OpenAI Schadenersatz zahlen und offenlegen, wie die Nutzung genau aussah und welche Erträge damit erzielt wurden.
Die Begründung ist schlüssig: Wenn ChatGPT einen kompletten Songtext nahezu fehlerfrei wiedergibt, kann das kein Zufall sein. Die Texte müssen im Training memorisiert worden sein – sie sind also Teil des KI-Modells. Das ist urheberrechtlich eine unerlaubte Vervielfältigung.
Was bedeutet das für euch als Nutzer?
Erstmal Entwarnung: Ihr könnt ChatGPT weiterhin normal nutzen. Das Urteil betrifft nicht eure Nutzung, sondern die Geschäftspraktiken von OpenAI. Allerdings werdet ihr schon jetzt merken, dass ChatGPT die Wiedergabe vieler Songtexte verweigert – mit dem Hinweis auf urheberrechtliche Gründe.
Interessant wird es bei der Frage: Was darf die KI eigentlich noch ausgeben? ChatGPT bietet mittlerweile eine „freie Übersetzung“ oder Zusammenfassung von Songtexten an, die explizit nicht dem Original entspricht. Das scheint der Versuch zu sein, das Problem zu umschiffen. Ob das rechtlich hält, müssen künftige Urteile zeigen.
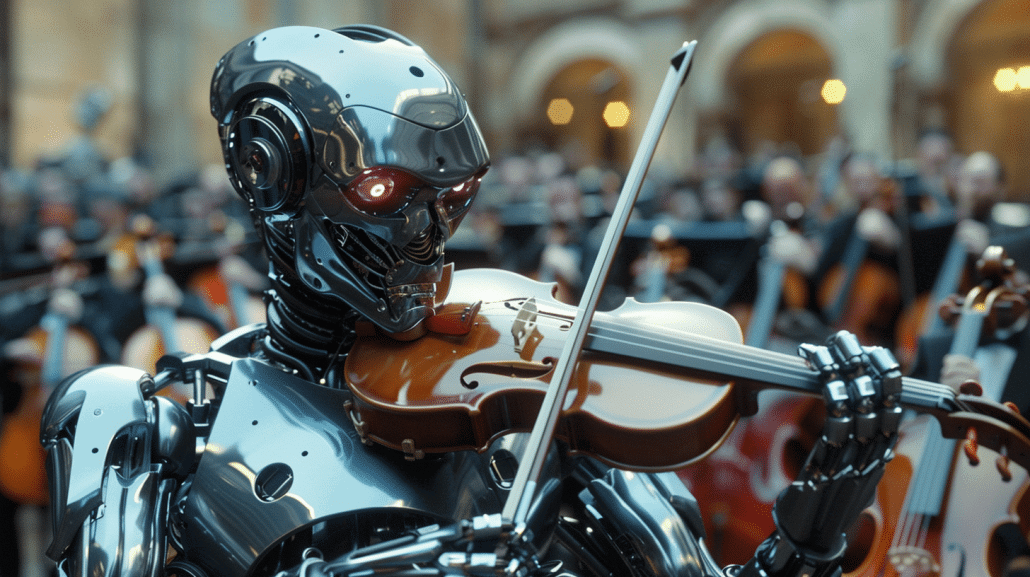
Der große Unterschied zu Google
Jetzt werdet ihr euch fragen: Moment mal, Google zeigt doch auch Songtexte in den Suchergebnissen an – ist das etwa auch illegal?
Nein! Und hier liegt der springende Punkt: Google hat Lizenzen. Seit 2016 arbeitet Google mit dem kanadischen Unternehmen LyricFind zusammen, das wiederum Lizenzverträge mit über 4.000 Musikverlegern in 100 Ländern hat. Jedes Mal, wenn ein Songtext über Google abgerufen wird, fließen Tantiemen an die Urheber.
Auch YouTube, das zu Google gehört, zahlt seit 2016 an die GEMA – nach jahrelangem Rechtsstreit. Daher könnt ihr als Content Creator heute GEMA-Musik in euren Videos verwenden, weil YouTube die Lizenzgebühren übernimmt.
OpenAI hingegen hat sich die Texte einfach genommen. Ohne zu fragen, ohne zu zahlen.
Warum ist das Urteil so wichtig?
Weil es weit über Songtexte hinausgeht. Das Münchner Urteil könnte zum Präzedenzfall für alle urheberrechtlich geschützten Werke werden – Literatur, journalistische Texte, Fotos, Illustrationen, Musik. Die Expertin Silke von Lewinski vom Max-Planck-Institut spricht von „grundlegender Bedeutung für alle Werke, die für Generative KI benutzt werden.“
Die Frage ist simpel: Ist das Internet ein Selbstbedienungsladen für KI-Firmen? Oder müssen auch Tech-Giganten wie OpenAI für die Nutzung kreativer Inhalte bezahlen?
Das Gericht hat heute klar gesagt: Auch KI muss sich an Regeln halten. Kreativleistungen sind keine Gratisvorlage.
Was passiert jetzt?
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. OpenAI hat bereits angekündigt, Rechtsmittel einzulegen. Es dürfte also noch durch mehrere Instanzen gehen – möglicherweise bis zum Bundesgerichtshof oder sogar zum Europäischen Gerichtshof.
Die GEMA bietet übrigens seit September 2024 ein Lizenzmodell speziell für KI-Anbieter an. OpenAI könnte also – gegen Zahlung – legal auf das GEMA-Repertoire zugreifen. Ob das Unternehmen diesen Weg geht, bleibt abzuwarten.
Die Krux mit dem Training
Technisch lässt sich das Problem nicht so einfach lösen. Nachträglich kann man keine Daten aus bereits trainierten KI-Modellen entfernen – das Training ist abgeschlossen. OpenAI müsste also neue Modelle ohne die geschützten Inhalte trainieren. Das wäre aufwendig und teuer.
Genau hier liegt der Konflikt: KI-Systeme brauchen riesige Datenmengen zum Training. Je mehr Daten, desto besser die Ergebnisse. Aber wenn all diese Daten lizenziert werden müssen, wird KI-Entwicklung deutlich teurer.
Die Tech-Branche argumentiert oft, dass KI-Training unter die „Text and Data Mining“-Ausnahme im Urheberrecht fallen könnte. Das Münchner Gericht sah das heute anders – zumindest, wenn die KI die Inhalte anschließend wieder ausgibt.
Meine Einschätzung
Das Urteil ist richtig und wichtig. Jahrzehntelang haben wir als Gesellschaft akzeptiert, dass Kreative für ihre Arbeit bezahlt werden. Wer im Radio einen Song spielt, zahlt an die GEMA. Wer ein Foto in einer Zeitung abdruckt, zahlt Lizenzgebühren. Warum sollte das für KI nicht gelten?
OpenAI und andere KI-Firmen hatten gehofft, sich in einer rechtlichen Grauzone bewegen zu können. Das funktioniert nicht mehr. Auch Algorithmen müssen sich an bestehende Gesetze halten.
Für uns Nutzer heißt das: KI-Dienste könnten teurer werden, wenn sie sauber lizenzieren müssen. Aber das ist der Preis für ein System, in dem kreative Arbeit einen Wert hat. Und das ist gut so.
Das Urteil sendet ein Signal weit über Deutschland hinaus: Die Zeit des digitalen Wilden Westens ist vorbei.
Das Urteil des Landgerichts München (Az. 42 O 14139/24) ist noch nicht rechtskräftig. Wir werden die Entwicklung weiter verfolgen.