
Copyright auf das eigene Gesicht: Dänemarks radikaler Deepfake-Plan
Dänemark will ein Copyright auf das eigene Gesicht, den eigenen Körper und die eigene Stimme einführen – wegen KI

Dänemark will ein Copyright auf das eigene Gesicht, den eigenen Körper und die eigene Stimme einführen – wegen KI


Was zunächst wie ein spektakulärer technischer Ausfall aussah, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Lehrstück über die unsichtbaren Kräfte, die unsere KI-Systeme lenken – und warum wir dringend mehr Transparenz brauchen


Das Designer-Shirt für 9,99 Euro auf Instagram, das iPhone zum halben Preis bei Amazon – was nach Schnäppchen aussieht, ist oft Betrug. Temu, Shein & Co. hebeln systematisch deutsches Recht aus. Wie Sie die Fallen erkennen und sich schützen.
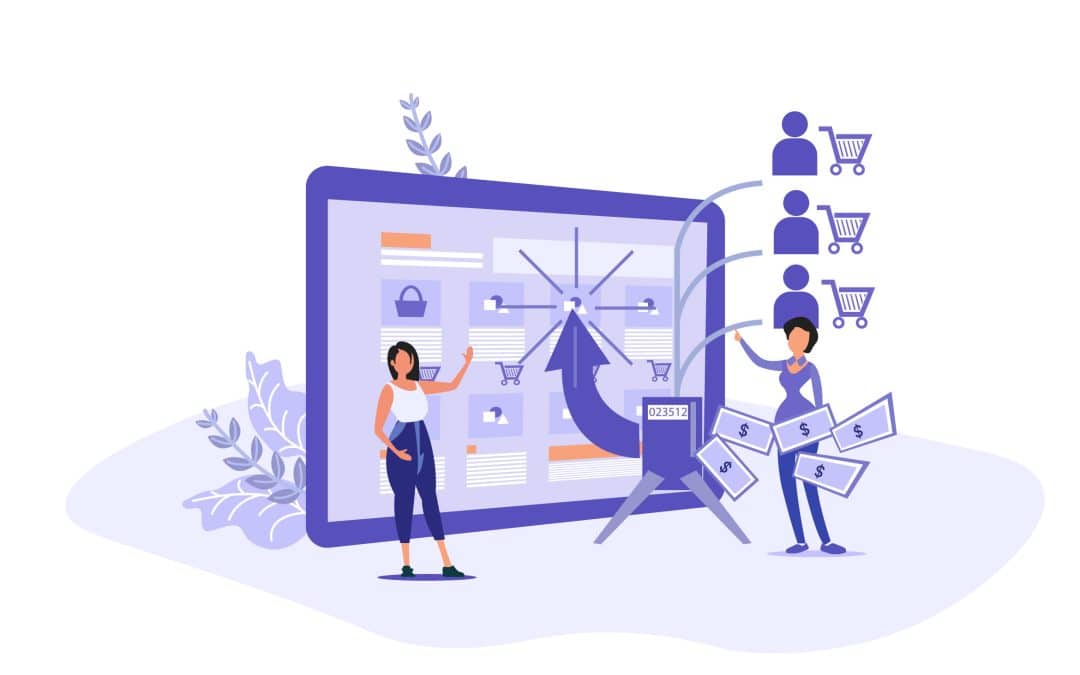
Ob Online-Shop, Banking-App oder Fahrkartenautomat: Viele digitale Angebote müssen jetzt barrierefrei sein. Ein riesiger Schritt für mehr digitale Teilhabe. Aber was heißt das konkret? Wer muss was umsetzen? Und warum betrifft uns das alle – auch wenn wir keine Behinderung haben?

Die Wartezeit ist vorbei: Googles revolutionäre Video-KI Veo 3 generiert ab sofort auch in Deutschland hochwertige Videos aus einfachen Textbeschreibungen. Was bisher nur mit VPN-Tricks möglich war, funktioniert jetzt offiziell – allerdings mit einigen Einschränkungen.
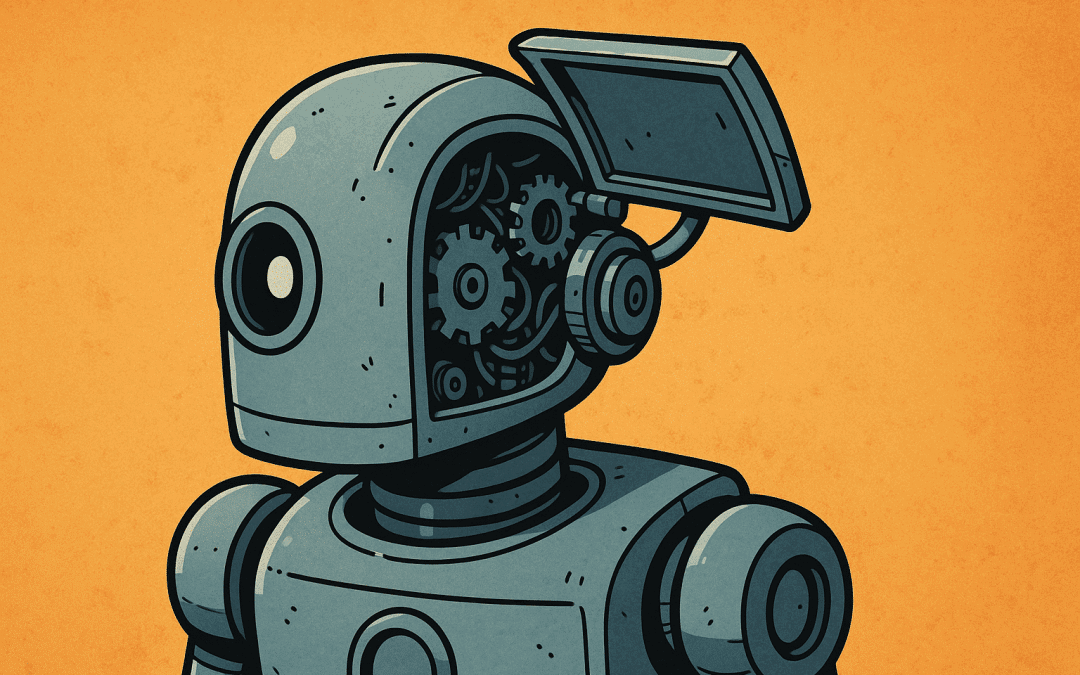
Du chattest täglich mit ChatGPT, Claude oder anderen KI-Assistenten. Aber hast du dir jemals gefragt, wer eigentlich bestimmt, wie diese digitalen Gesprächspartner ticken? Die Antwort liegt in den sogenannten Systemprompts – und die sind in den letzten Wochen in großem Stil geleakt worden.

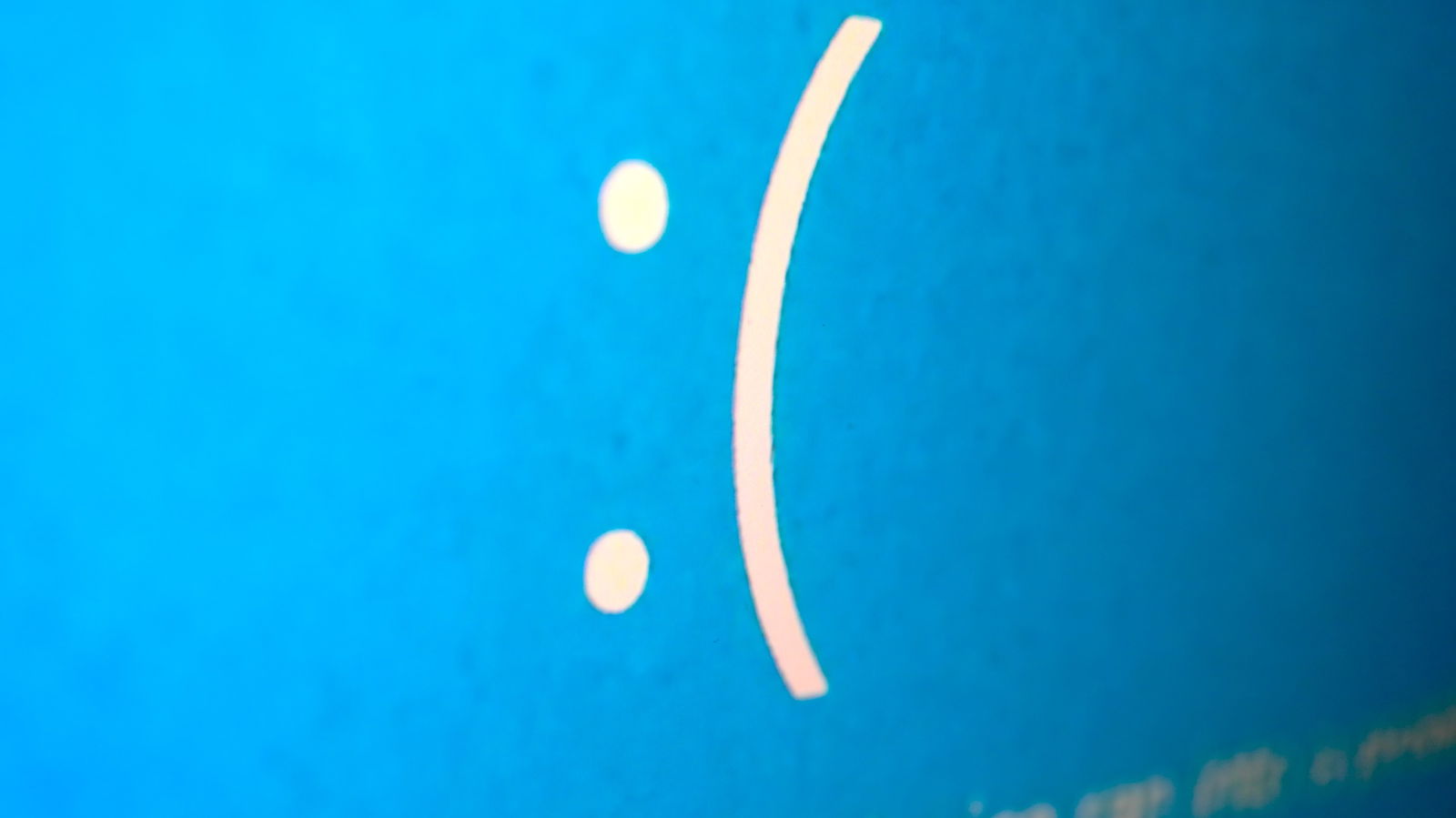
Es ist soweit: Microsoft plant mit dem kommenden Update für Windows 11 (Version 24H2) den Blue Screen of Death (BSOD) gegen einen modernen, schwarzen Bildschirm auszutauschen. Nach vier Jahrzehnten treuer Dienste geht eine Legende in den Ruhestand – und nimmt dabei sogar ihr ikonisches Smiley-Gesicht mit.