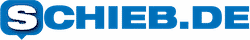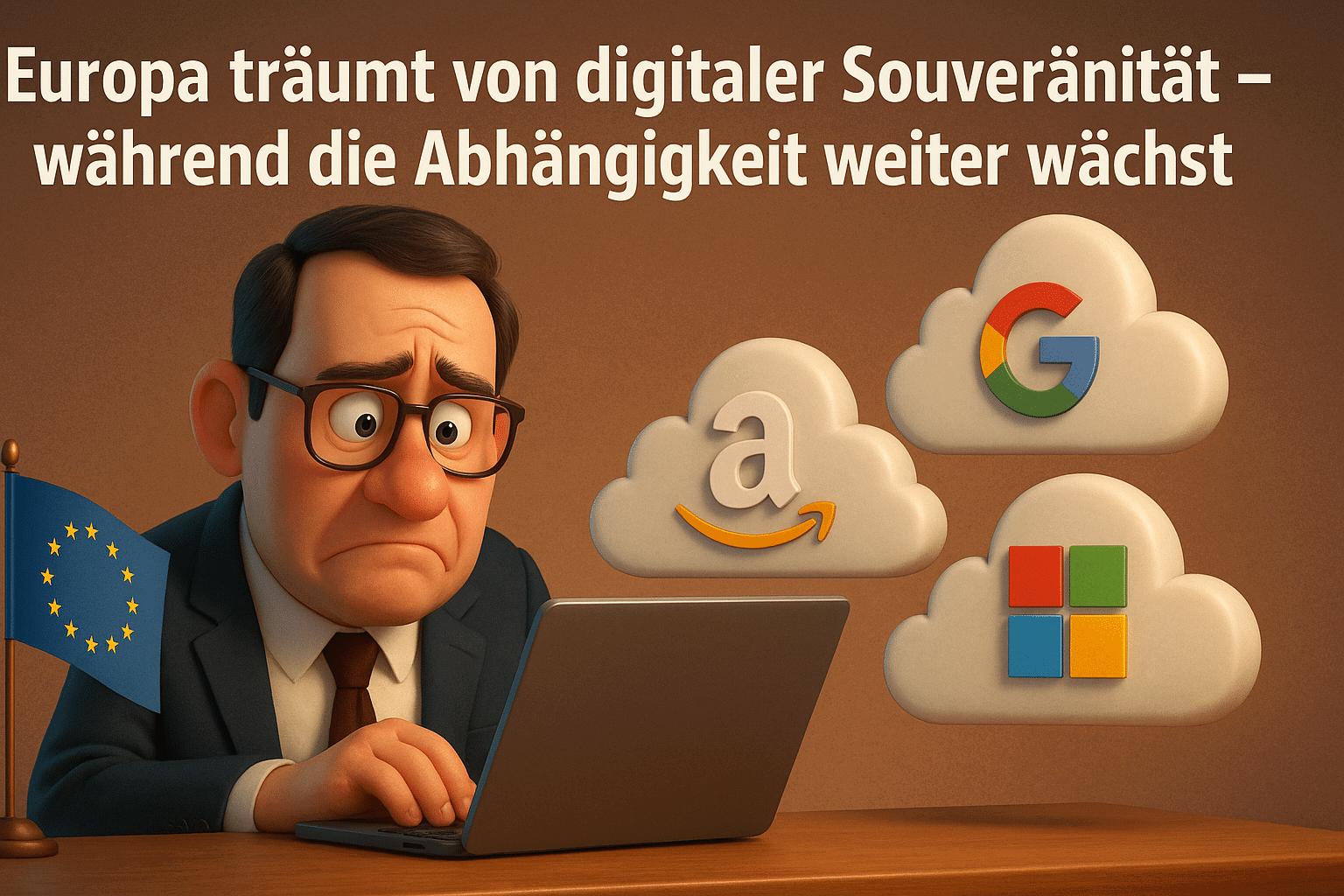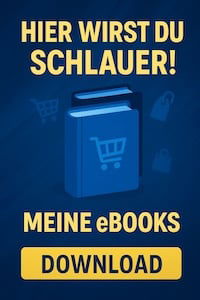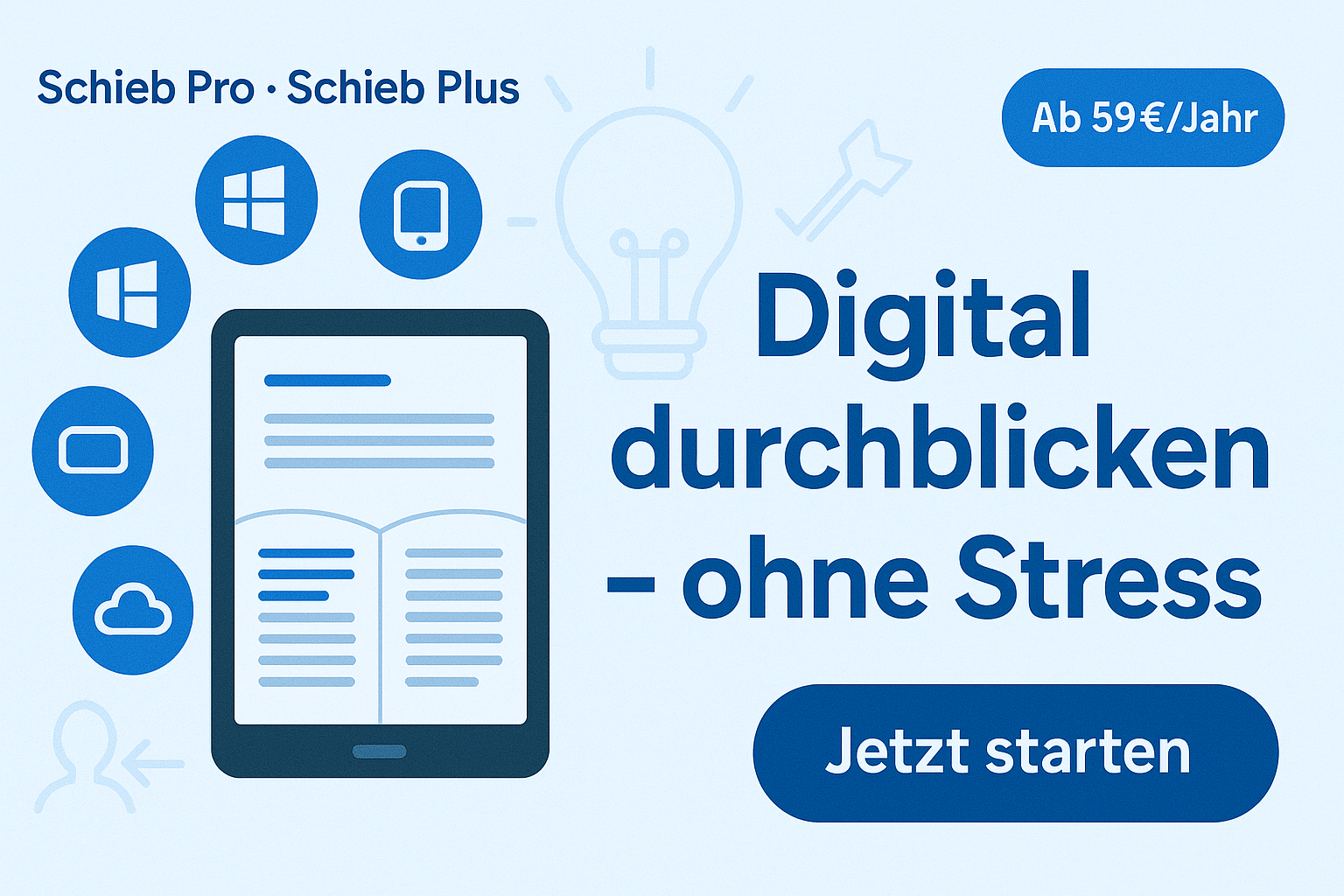Wenn sich über 1.000 hochrangige Gäste aus Politik und Wirtschaft in Berlin treffen, um über „Europäische Digitale Souveränität“ zu diskutieren, klingt das zunächst nach großer Aufbruchstimmung.
Bundeskanzler Friedrich Merz, Emmanuel Macron, EU-Digitalminister und die Chefs von SAP, Telekom und Siemens – sie alle versammeln sich, um endlich Europas digitale Unabhängigkeit voranzutreiben. Doch bei genauerer Betrachtung entpuppt sich der Gipfel als Treffen der IT-Abgehängten, die Jahre zu spät erkannt haben, wie tief sie in der Abhängigkeit stecken.
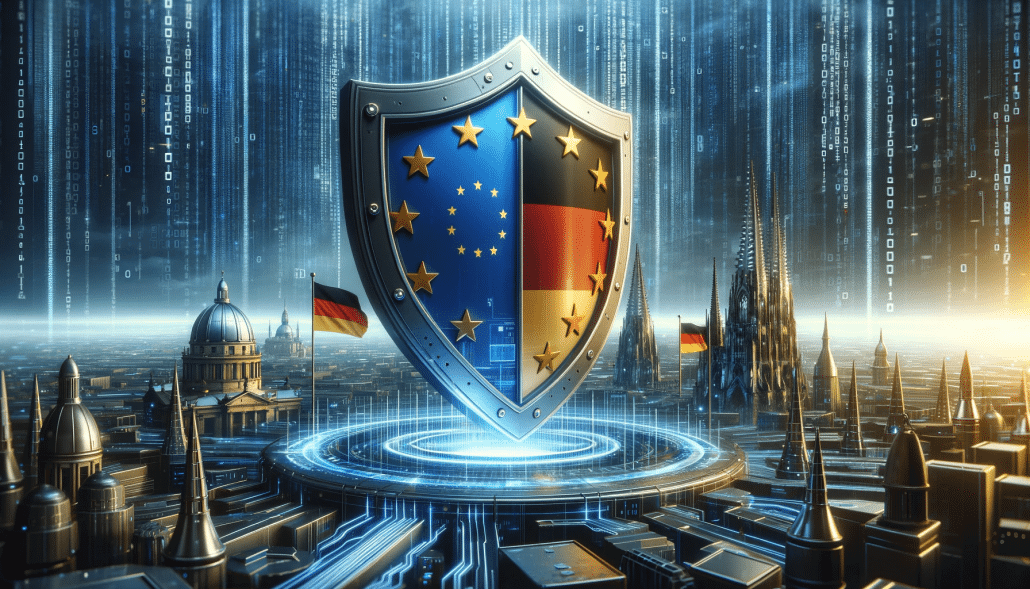
Die bittere Realität: Europa hat den Anschluss verpasst
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 90 Prozent der deutschen Unternehmen nutzen Cloud-Dienste – und landen damit fast ausnahmslos bei Amazon AWS, Microsoft Azure oder Google Cloud. 89 Prozent sehen sich abhängig vom Ausland. 96 Prozent der Bevölkerung macht es Sorge, dass Deutschland bei der Digitalisierung zu abhängig ist. Das Problem ist längst erkannt. Aber was ist die Reaktion? Ein Gipfel mit schönen Reden und vagen Absichtserklärungen.
Während in Berlin über digitale Souveränität philosophiert wird, pumpen US-Konzerne Milliarden in KI-Entwicklung und bauen ihren Vorsprung täglich aus. OpenAI, Google, Meta – sie definieren die digitale Zukunft. Europa schaut zu und redet über „Regulierung“ und „Ethik“, als ob das eine Antwort auf fehlende Innovation wäre.
Was seit Jahren schief läuft
Die Geschichte europäischer Digital-Projekte ist eine Geschichte des Scheiterns. Erinnert ihr euch an Gaia-X? Das europäische Cloud-Projekt wurde 2019 mit großem Trara verkündet. Heute ist es ein Schatten seiner selbst – kompliziert, langsam und im Wettbewerb chancenlos. Das Problem: Europa denkt in Gremien, Arbeitsgruppen und Abstimmungsrunden. Silicon Valley denkt in Produkten.
Auch die KI-Strategie ist bezeichnend: Während die USA und China längst KI-Modelle trainieren, die ganze Industrien umkrempeln, diskutiert Europa über den AI Act. Regulierung ist wichtig – aber ohne eigene wettbewerbsfähige Technologie regeln wir nur, wie wir die Produkte anderer nutzen dürfen. Das ist keine Souveränität, das ist verwaltete Abhängigkeit.

Die Illusion der schnellen Lösung
Jetzt also der große Wurf: Deutschland und Frankreich wollen gemeinsam vorangehen. Kritische Daten sollen in der EU bleiben, Open-Source-Tools ausgebaut werden, die EU-Wallet beschleunigt werden. Schleswig-Holstein wird als Vorzeigebeispiel genannt, weil dort Microsoft Office durch Open-Source-Alternativen ersetzt wird. Das ist schön – aber im globalen Maßstab eine Fußnote.
Die Wahrheit ist: Europa hat nicht nur ein technologisches Problem, sondern ein strukturelles. Wir haben keine digitale Kultur des schnellen Scheiterns und Neustartens. Wir haben keine Risikokapital-Kultur wie in den USA. Wir haben keinen Binnenmarkt, der wirklich funktioniert – 27 verschiedene Datenschutzinterpretationen, 27 verschiedene Digitalstrategien, 27 verschiedene Förderprogramme.
Was wirklich nötig wäre
Digitale Souveränität ist nicht unmöglich – aber sie erfordert radikale Schritte, nicht Sonntagsreden. Europa müsste:
Milliarden in echte Innovation pumpen – nicht in Bürokratie, sondern in Forschung, Start-ups und Infrastruktur. Ein europäisches Cloud-System kostet Milliarden, ja. Aber was kostet uns die Abhängigkeit? Die USA könnten theoretisch jederzeit auf europäische Daten zugreifen. Das ist kein abstraktes Risiko, das ist eine reale Bedrohung für Wirtschaft und Sicherheit.
Den Binnenmarkt wirklich vollenden – ein deutsches Start-up, das nach Frankreich expandieren will, braucht heute oft einen eigenen Rechtsberater. Das ist absurd. Wir brauchen echte europäische Champions, nicht 27 nationale Insellösungen.
Mut zu eigenen Standards – warum sollte Europa nicht Open-Source als Grundprinzip für öffentliche Infrastruktur festlegen? Warum nicht massiv in LibreOffice, Nextcloud oder andere europäische Alternativen investieren? Transparenz, Sicherheit, Anpassbarkeit – das wären echte europäische Werte, nicht nur Marketingversprechen.
Geschwindigkeit erhöhen – während der „Digitale Omnibus“ diskutiert wird (ein Gesetzespaket, das ausgerechnet Datenschutzvorgaben lockern soll), baut China seine digitale Infrastruktur aus und die USA dominieren weiter die KI-Entwicklung. Europa muss schneller werden, ohne seine Werte zu verraten.
Das Dilemma der späten Erkenntnis
Das Tragische an diesem Gipfel ist: Die Probleme sind alle bekannt, die Lösungen liegen auf dem Tisch – aber es fehlt der politische Wille zur Umsetzung. Wir reden seit Jahren über digitale Souveränität, während die Abhängigkeit weiter wächst. Jedes Unternehmen, das heute zu Microsoft 365 wechselt, jede Behörde, die ihre Daten in die AWS-Cloud legt, verfestigt unsere Abhängigkeit.
Der Bitkom-Präsident sagt es richtig: „Digitale Abhängigkeiten sind kein abstraktes Risiko.“ 65 Prozent der Deutschen halten digitale Abhängigkeit für ähnlich bedrohlich wie militärische Gefahren. Die Bevölkerung hat das längst verstanden. Nur die Politik handelt nicht entsprechend.
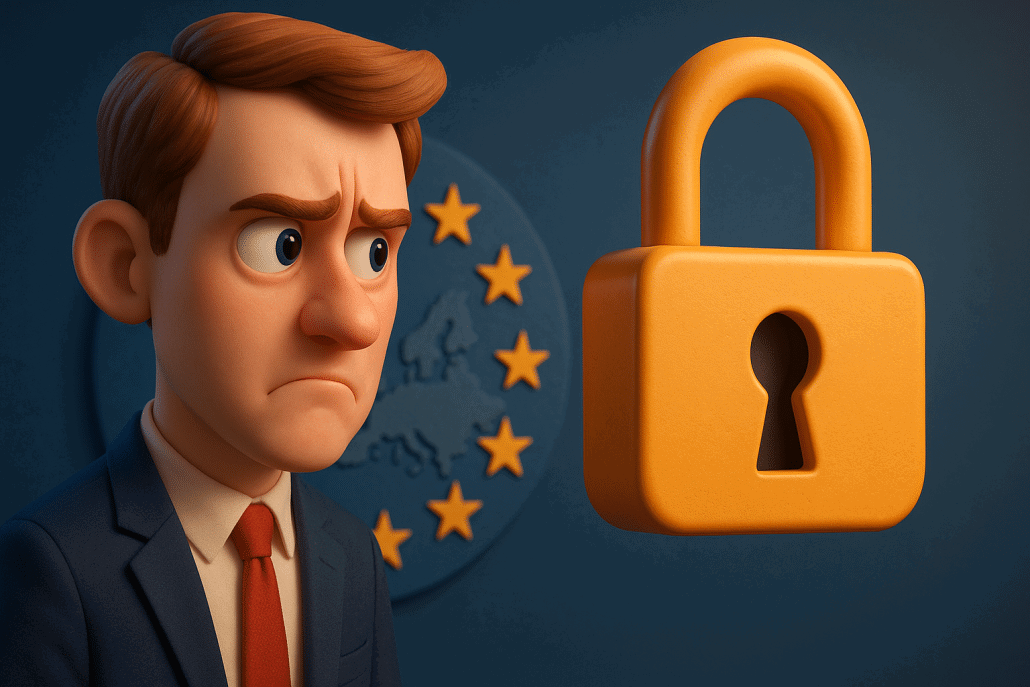
Ein Gipfel reicht nicht
Was in Berlin passiert, ist bestenfalls ein Anfang – wenn überhaupt. Ein Signal, dass man das Problem erkannt hat. Aber Signale reichen nicht. Europa braucht keine weiteren Gipfel, Arbeitsgruppen und Taskforces. Europa braucht Investitionen, Geschwindigkeit und den Mut, auch mal zu scheitern.
Solange wir weiter darüber reden, wie wichtig digitale Souveränität ist, während gleichzeitig jede Verwaltung auf Microsoft setzt und jedes Unternehmen seine Daten bei Amazon speichert, bleibt es beim Gipfel der IT-Abgehängten. Europa muss endlich vom Reden ins Handeln kommen – bevor die digitale Abhängigkeit so groß wird, dass wir gar keine Wahl mehr haben.
Die Frage ist nicht, ob Europa digitale Souveränität erreichen kann. Die Frage ist, ob Europa es wirklich will – und bereit ist, den Preis dafür zu zahlen.