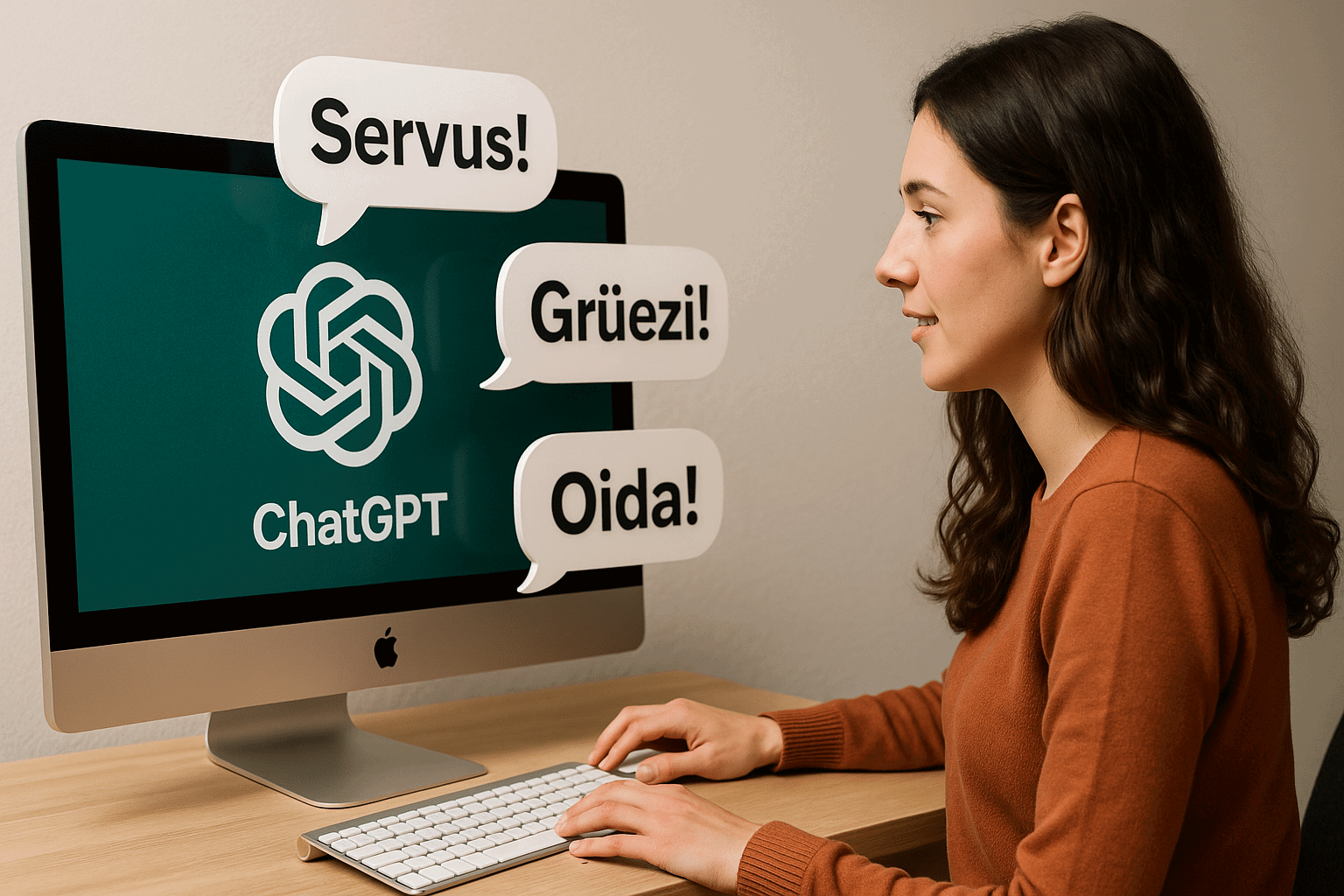Millionen Menschen nutzen täglich ChatGPT, Meta AI in WhatsApp oder andere KI-Assistenten. Doch wer nicht lupenreines Hochdeutsch spricht, erlebt oft eine böse Überraschung: Die smarten Bots verstehen Bahnhof – und das nicht mal am Münchner Hauptbahnhof.
Während sich Sprachmodelle wie ChatGPT oder Meta AI bei Standarddeutsch meist recht sicher bewegen, stoßen sie bei regionalen Dialekten schnell an ihre Grenzen. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch ein echtes Problem für digitale Barrierefreiheit und Inklusion.
Die wissenschaftliche Beweislage ist eindeutig
Die Ludwig-Maximilians-Universität München hat gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk untersucht, wie gut KI-Systeme mit bairischen, fränkischen und schwäbischen Dialekten zurechtkommen. Das Ergebnis fällt ernüchternd aus: Die automatische Spracherkennung macht bei Dialekten deutlich mehr Fehler als bei Hochdeutsch. Teilweise ging dabei nicht nur die Grammatik verloren, sondern gleich der komplette Sinn der Sätze.
Das Problem betrifft alle gängigen Sprachmodelle – von OpenAIs ChatGPT über Metas Llama-basierte KI bis hin zu anderen Large Language Models. Ohne spezielles Training mit regionalen Sprachdaten sind diese Systeme schlicht nicht in der Lage, Dialekte zuverlässig zu verarbeiten.
Meta AI: Der Dialekt-Stolperstein in WhatsApp
Besonders brisant wird die Sache bei Meta AI. Der Konzern hat seinen KI-Assistenten tief in WhatsApp, Instagram und Facebook integriert. Millionen Nutzer können den Bot direkt in ihren Chats aktivieren und Fragen stellen. Theoretisch eine geniale Sache – praktisch aber nur für Menschen, die perfektes Hochdeutsch schreiben.
Wer seinem Kumpel auf WhatsApp schreibt „Oida, frog amal die KI, wann des Konzert is“, wird vermutlich keine brauchbare Antwort bekommen. Meta AI ist – wie die meisten großen Sprachmodelle – primär auf Standardsprache trainiert. Regionale Ausdrücke, Dialektformen und umgangssprachliche Wendungen bleiben oft unverstanden.
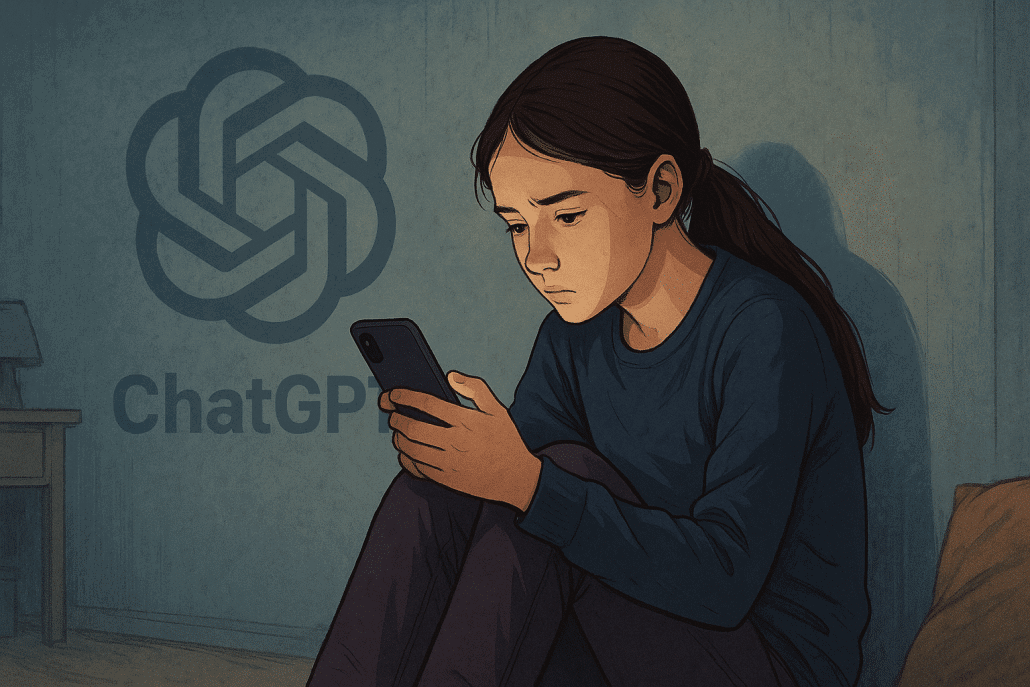
Schweizerdeutsch: Ein Buch mit sieben Siegeln
Für Schweizer Nutzer ist die Lage besonders verzwickt. Schweizerdeutsch unterscheidet sich stark vom Hochdeutschen – nicht nur in der Aussprache, sondern auch in Grammatik und Wortschatz. Wörter wie „Chuchichäschtli“ (Küchenschrank) bringen jeden KI-Bot ins Schwitzen.
Immerhin gibt es hier Hoffnung: An der ETH Zürich entwickeln Forscher mit „Apertus“ ein Sprachmodell, das gezielt mit Schweizerdeutsch trainiert wird. Das Projekt zeigt erste Erfolge, aber auch seine Grenzen. Vergleichstests belegen, dass selbst diese spezialisierten Modelle bei Dialekten deutlich schlechter abschneiden als bei Standardsprache. Die Fehlerquote liegt weiterhin spürbar höher, und die Verständlichkeit lässt oft zu wünschen übrig.
Österreichisch und Wienerisch: Die große Forschungslücke
Noch düsterer sieht es für österreichische Dialekte aus. Während es für Bairisch und Schweizerdeutsch zumindest einzelne Forschungsprojekte gibt, fehlen für Wienerisch oder andere österreichische Dialektformen umfassende wissenschaftliche Studien fast vollständig.
Nutzer berichten aus der Praxis: ChatGPT und Co. verstehen bei Ausdrücken wie „Oida, geh bitte!“ oder „Des passt scho“ zwar vage, dass da jemand etwas kommunizieren möchte – aber was genau gemeint ist, bleibt meist Kaffeesudleserei. Regionale Eigenheiten und Idiome werden entweder falsch interpretiert oder gleich ganz ignoriert.
Selbst in Südtirol, wo mit deutschsprachigen Standardvarietäten experimentiert wurde, zeigen Studien: Auch gezielte Prompts und Glossare stoßen schnell an Grenzen. Das Ergebnis sind oft grammatikalische Fehler oder zu stark „verhochdeutschte“ Texte, die den regionalen Charakter verlieren.
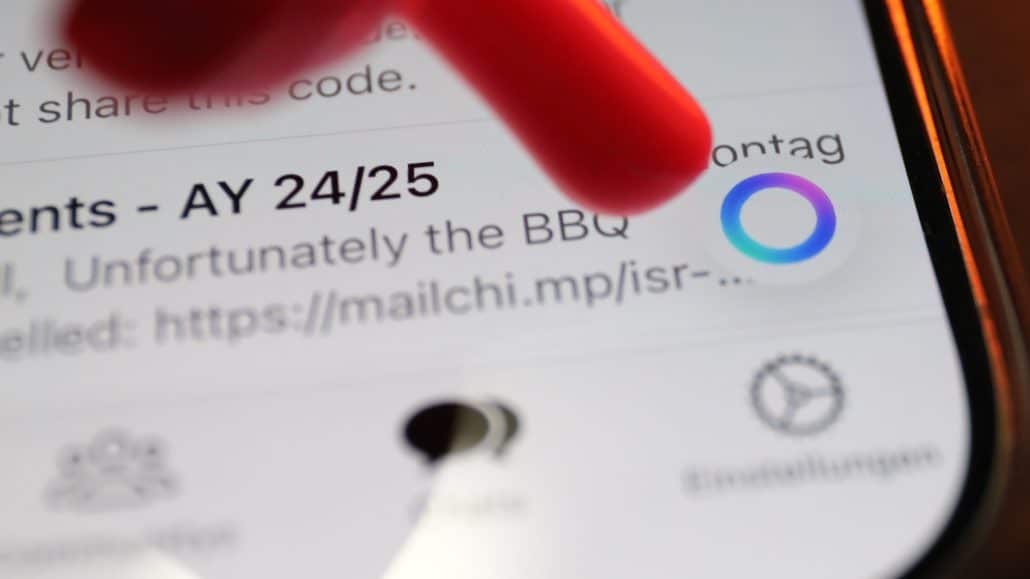
Warum ist das mehr als ein Luxusproblem?
Man könnte jetzt einwenden: Na und? Dann schreiben die Leute eben Hochdeutsch. Doch so einfach ist es nicht. Sprache ist Identität. Dialekte sind Teil unserer kulturellen Vielfalt. Und wenn KI-Systeme nur Standardsprache verstehen, diskriminieren sie faktisch Millionen Menschen.
Das wird besonders problematisch, wenn KI-Tools in immer mehr Lebensbereiche vordringen. Ob Kundenservice-Chatbots, Sprachassistenten im Auto oder KI-gestützte Übersetzungen – wer nicht „richtig“ spricht, bleibt außen vor. Das widerspricht dem Anspruch, dass digitale Technologien für alle zugänglich sein sollen.
Forscherinnen der Universität Hamburg haben in einer Studie untersucht, wie Sprachmodelle deutsche Dialektsprecher diskriminieren. Ihr Fazit: Die aktuellen Systeme benachteiligen Menschen, die mit Dialekt aufgewachsen sind, systematisch.
Was kannst du tun? Praktische Tipps
Switche bewusst ins Hochdeutsche: Wenn du KI-Tools für wichtige Aufgaben nutzt, formuliere deine Anfragen in Standarddeutsch. Das erhöht die Chance auf brauchbare Antworten drastisch.
Teste die Grenzen: Probiere ruhig mal aus, wie dein Dialekt bei ChatGPT, Meta AI oder anderen Bots ankommt. So bekommst du ein Gefühl dafür, wo die Schwächen liegen.
Gib Feedback: Wenn ein KI-System deinen Dialekt nicht versteht, melde das dem Anbieter. Nur wenn das Problem sichtbar wird, entsteht Druck zur Verbesserung.
Nutze spezialisierte Tools: Für manche Dialekte gibt es bereits Apps und Projekte, die sich gezielt damit beschäftigen. Die „DaBay“-App der LMU etwa sammelt bairische Sprachdaten für die Forschung.
Ein langer Weg liegt vor uns
Die gute Nachricht: Es tut sich was. Open-Source-Initiativen, universitäre Forschungsprojekte und spezialisierte Trainingskorpora arbeiten daran, Sprachmodelle dialektfähiger zu machen. Das Leibniz-Rechenzentrum entwickelt beispielsweise ein 10-Milliarden-Parameter-Modell speziell für bayerische Dialekte.
Doch der Weg ist lang. Während Hochdeutsch-Verarbeitung bereits sehr ausgereift ist, stecken Dialekte noch in den Kinderschuhen. Es braucht massive Mengen an regionalem Trainingsmaterial, linguistische Expertise und den Willen der großen Tech-Konzerne, in Sprachvielfalt zu investieren.
Bis dahin gilt: Wenn ChatGPT, Meta AI oder andere Bots deinen Dialekt nicht verstehen, liegt das nicht an dir. Du sprichst nicht „falsch“ – die KI ist einfach noch nicht so weit. Und das sollte sich ändern.
Denn echte Intelligenz zeigt sich auch darin, Vielfalt zu verstehen – nicht nur Standards.