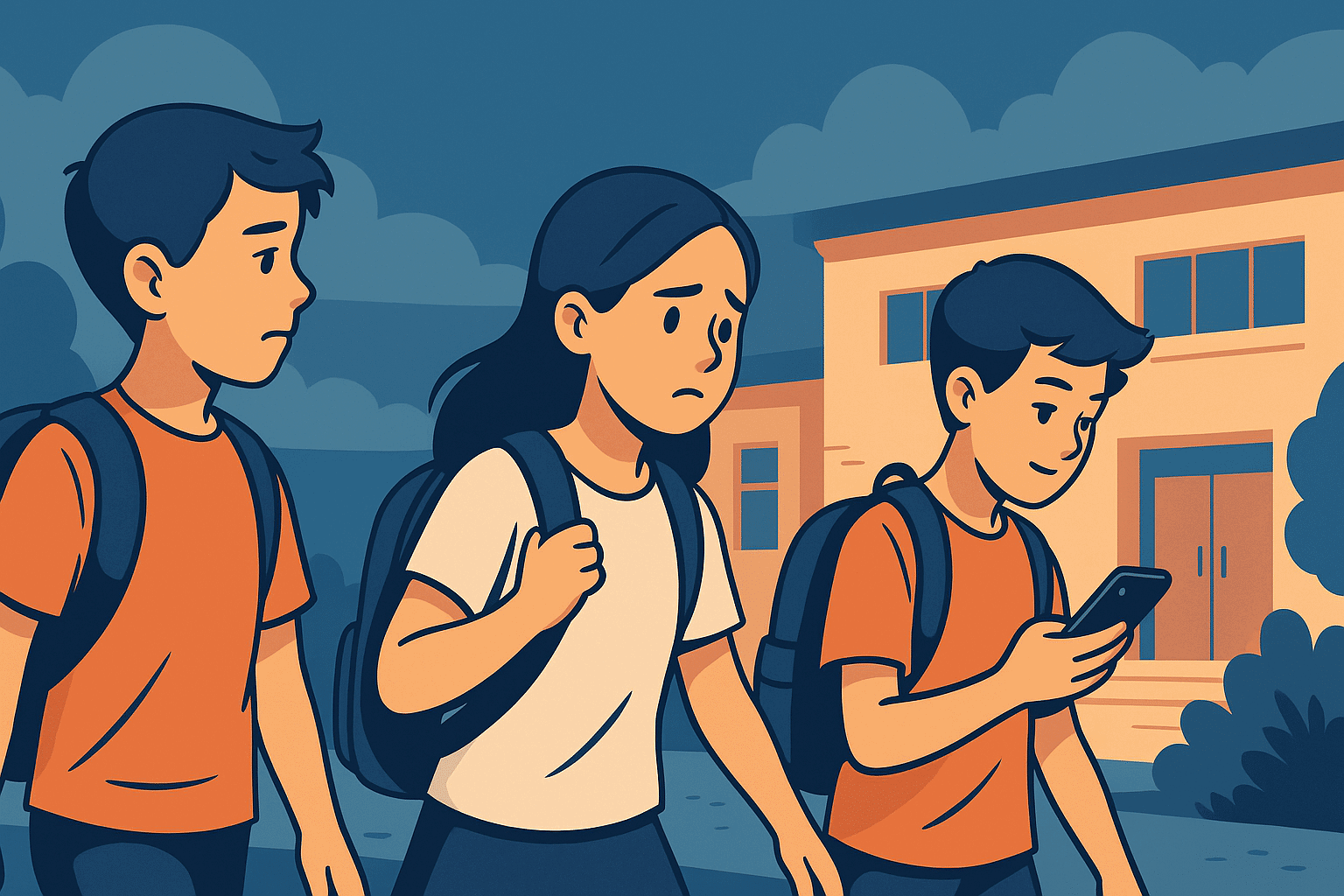Schulstart in NRW – und drei verschiedene Ansätze zeigen, wie kontrovers der Umgang mit Smartphones und Social Media an Schulen diskutiert wird. Von radikalen Experimenten bis hin zu neuen Schulfächern: Was funktioniert wirklich?
Mit dem Schuljahresbeginn in Nordrhein-Westfalen flammt eine Debatte auf, die Eltern, Lehrer und Bildungspolitiker gleichermaßen beschäftigt: Wie sollen wir mit Handys und Social Media in der Schule umgehen? Drei aktuelle Entwicklungen zeigen völlig unterschiedliche Ansätze – und alle haben ihre Berechtigung.
Das Solinger Experiment: Radikal, aber durchdacht
In Solingen startet gerade ein deutschlandweit einzigartiges Projekt: Alle Fünftklässler sollen auf TikTok, Instagram und Snapchat verzichten – nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause. Das klingt zunächst nach einem radikalen Schritt, ist aber durchaus durchdacht.
Das Besondere: Es ist nicht nur ein Schulverbot. Alle 42 Schulen der Stadt ziehen an einem Strang – zusammen mit den Eltern. Die Verantwortung wird durch sogenannte Erziehungsvereinbarungen gemeinsam geregelt, unterzeichnet von Schulen und Erziehungsberechtigten.
Die Idee dahinter ist psychologisch schlau: Wenn alle Fünftklässler auf Social Media verzichten, gibt es keinen sozialen Druck mehr, dazuzugehören. Kein Kind muss mehr das Gefühl haben, außen vor zu sein, weil es kein Instagram hat.

Der Antreiber des Projekts ist Markus Surrey, Leiter des schulpsychologischen Dienstes in Solingen. Er verweist auf erschreckende offizielle Zahlen des Statistischen Bundesamtes: 2021 wurden in Deutschland knapp 81.000 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren wegen psychischer Erkrankungen und Verhaltensstörungen stationär im Krankenhaus behandelt – das entspricht 19 Prozent aller Krankenhausbehandlungen in dieser Altersgruppe. Die häufigste Einzeldiagnose: Depressionen mit über 21.900 Fällen.
Zum Vergleich: Bei Erwachsenen machen psychische Erkrankungen nur 6 Prozent der Krankenhausbehandlungen aus. Surrey argumentiert, dass diese dramatische Entwicklung stark mit der intensiven Smartphone- und Social-Media-Nutzung zusammenhängt.
Die Skepsis ist durchaus berechtigt: Kritiker fragen zu Recht, ob ein Jahr des Verzichts wirklich langfristig hilft oder ob die Kinder danach umso intensiver in die digitale Welt eintauchen. Aber als Pilotprojekt ist es wertvoll – wir werden lernen, was passiert, wenn eine ganze Generation temporär offline geht.
Der NRW-Weg: Demokratie statt Diktat
Ganz anders geht NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) vor. Statt landesweiter Verbote überlässt sie es jeder Schule selbst, bis Herbst 2025 eigene altersgerechte Regeln für die private Handynutzung zu entwickeln und verbindlich in die Schulordnung aufzunehmen.
Für Grundschulen gibt es eine klare Empfehlung: Die private Nutzung von Handys und Smartwatches sollte auf dem Schulgelände grundsätzlich nicht erlaubt sein. Für weiterführende Schulen setzt Feller auf maßgeschneiderte Lösungen.
Der Ansatz ist klug: Jede Schule hat ihre eigene Schülerschaft, ihre eigenen Herausforderungen und ihre eigene Kultur. In einer Arbeitsgruppe aus Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern, Eltern sowie gegebenenfalls der Schulsozialarbeit sollen die aktuelle Praxis analysiert und neue Regeln entwickelt werden.
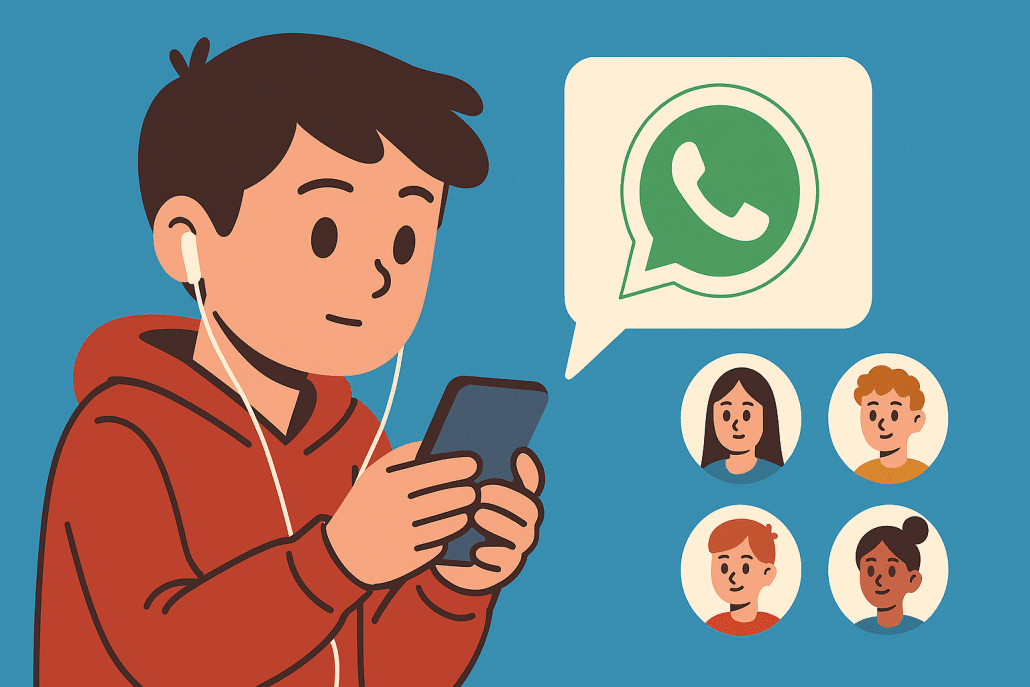
Feller betont einen wichtigen demokratischen Aspekt: „Wenn Schülerinnen und Schüler aktiv an der Gestaltung der Handyregeln mitwirken, lernen sie, unterschiedliche Perspektiven abzuwägen, Kompromisse zu finden und Verantwortung für gemeinsame Entscheidungen zu übernehmen.“
Das ist wissenschaftlich der sinnvollste Ansatz. Denn überraschenderweise gibt es nur wenige belastbare Studien darüber, was Handy-Verbote wirklich bringen. Eine 2016 veröffentlichte Studie aus England stellte fest, dass sich die Testergebnisse nach Einführung eines Handyverbots deutlich verbesserten – besonders bei leistungsschwächeren Schülern. Aber schwedische Forscher konnten das 2019 nicht mehr reproduzieren.
Die neueste deutsche Studie der Uni Augsburg zeigt gemischte Ergebnisse: Smartphone-Verbote verbessern das soziale Wohlbefinden von Schülern signifikant, haben aber nur einen geringen positiven Effekt auf die Lernleistungen. Das heißt: Es wirkt, aber nicht wie ein Wundermittel.
Deshalb ist der NRW-Ansatz richtig: Verschiedene Schulen probieren verschiedene Konzepte aus, und dann kann evidenzbasierte Bildungspolitik daraus lernen.
Der Bildungsansatz: Medienkompetenz als Schulfach
Den dritten Weg schlägt der Sozialverband Deutschland (SoVD) vor: ein verpflichtendes Schulfach Medienkompetenz an allen weiterführenden Schulen. „Wir dürfen Kinder mit den Gefahren der digitalen Welt nicht länger alleinlassen“, fordert SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier.
Ihr Argument ist bestechend: „Nicht alle Kinder profitieren durch eine Vorbildung im Elternhaus. Viele sind Desinformation, demokratiefeindlicher Hetze und KI-generierten Inhalten schutzlos ausgesetzt, ohne Anleitung, ohne Einordnung.“
Die Zahlen geben ihr recht: Laut der Studie „Jugend, Information, Medien“ (JIM) waren 12- bis 19-Jährige im vergangenen Jahr durchschnittlich 201 Minuten täglich online. Dabei stießen 61 Prozent auf Fake News, 40 Prozent berichteten von Hate Speech, 25 Prozent hatten ungewollten Kontakt zu pornografischen Inhalten – und 13 Prozent wurden persönlich beleidigt.
Ein eigenständiges Schulfach sollte über technische Grundkenntnisse hinausgehen und den kritischen, verantwortungsvollen und datensensiblen Umgang mit digitalen Medien, sozialen Netzwerken und Plattformlogiken vermitteln.
Denn wie will man einem Kind erklären, was Cyber-Grooming ist, wenn es nie gelernt hat, kritisch mit digitalen Medien umzugehen? Wie soll es Deepfakes erkennen, wenn niemand erklärt hat, wie KI funktioniert?

Die Lösung liegt in der Kombination
Alle drei Ansätze haben ihre Berechtigung, und vermutlich liegt die Lösung in einer intelligenten Kombination:
Vernünftige Regeln für die Schulzeit – entwickelt von den Schulgemeinschaften selbst, nicht von oben diktiert. Experimentelle Projekte wie in Solingen, aus denen wir lernen können. Und vor allem: Echte Medienkompetenz-Bildung, die über das bloße Bedienen von Apps hinausgeht.
Denn am Ende geht es nicht darum, die digitale Welt zu verteufeln oder unsere Kinder davon abzuschotten. Es geht darum, sie zu mündigen, kritischen und selbstbestimmten Nutzern zu machen. Und das schaffen wir nur mit Bildung, nicht mit Verboten allein.
Die nächsten Jahre werden zeigen, welcher Mix am besten funktioniert. Entscheidend ist, dass wir endlich anfangen, evidenzbasiert statt emotional zu handeln. Unsere Kinder haben das verdient.